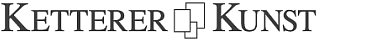Auktion: 590 / Evening Sale am 06.06.2025 in München  Lot 124001375
Lot 124001375
 Lot 124001375
Lot 124001375
124001375
Hermann Max Pechstein
Märzenschnee: Der Bahndamm, 1909.
Öl auf Leinwand
Schätzpreis: € 200.000 - 300.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Märzenschnee: Der Bahndamm. 1909.
Öl auf Leinwand.
Rechts unten monogrammiert und datiert. 55 x 51 cm (21,6 x 20 in).
• 1909: kraftvoll leuchtende Landschaft aus der Berliner "Brücke"-Zeit.
• 1909: Mit diesem Gemälde gelingt Pechstein erstmals die Teilnahme an der Frühjahrsausstellung der Berliner Secession, die ihm zu seinem künstlerischen Durchbruch verhilft.
• 1909: Walther Rathenau, späterer Reichsaußenminister (1922), erwirbt diese Arbeit für seine private Kunstsammlung.
• Ein vergleichbares Gemälde befindet sich in den Kunstsammlungen Chemnitz, ein weiteres gilt als verschollen.
• Max Pechstein ist von der gleißenden Märzsonne und ihren Reflexen im Frühjahrsschnee gefangen.
• Was in dieser Zeit entsteht, ist wegweisend für Pechsteins expressionistische Malweise, die 1910 ihren Höhepunkt erreicht.
PROVENIENZ: Walther Rathenau (Berliner Secession 1909).
Nachlass Rathenau (1922/23).
Walther-Rathenau-Stiftung (1923-1934).
Fritz und Edith Andreae, geb. Rathenau (1934-1936).
Privatbesitz Nordrhein-Westfalen (wohl Ende der 1950er Jahre erworben in der Galerie Großhennig).
Seither in Familienbesitz.
Gütliche Einigung des Vorgenannten mit den Erben von Fritz und Edith Andreae (2025).
Wir danken Anna B. Rubin, HCPO New York, und Wolfgang Andreae, Walther Rathenau Gesellschaft e. V., für die freundliche Unterstützung.
AUSSTELLUNG: Internationale Kunstausstellung 1909, Berliner Secession, Berlin, 1909, Kat.-Nr. 195 (hier: Märzenschnee) (verso auf dem Keilrahmen mit einem Etikett).
Walther Rathenau 1867-1922. Die Extreme berühren sich, Deutsches Historisches Museum, Berlin, 9.12.1993-8.2.1994, Kat.-Nr. 2/33, Farbabb. S. 302.
Max Pechstein. Sein malerisches Werk, Brücke-Museum Berlin / Kunsthalle Tübingen / Kunsthalle Kiel, 1996/97, Kat.-Nr. 13 (m. Farbabb.) (hier: "Märzenschnee III").
Im Farbenrausch. Munch, Matisse und die Expressionisten, Museum Folkwang, Essen, 29.9.2012-13.1.2013, Kat.-Nr. 126, Farbabb. S. 238.
LITERATUR: Aya Soika, Max Pechstein. Das Werkverzeichnis der Ölgemälde, Bd. 1: 1905-1918, München 2011, WVZ-Nr. 1909/7 (m. Farbabb.).
- -
Auktionshaus Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal, Berlin, 13.6.1936, Los 518 (hier: "Der Bahndamm").
Leopold Reidemeister (Hrsg.), Max Pechstein. Erinnerungen, Wiesbaden 1960, S. 34.
Edwin Redslob, Von Weimar nach Europa. Erlebtes und Durchdachtes, Berlin 1972, S. 185.
Leopold Reidemeister, Das Brücke-Museum, Berlin 1984, S. 48.
Henrike Junge-Gent, Avantgarde und Publikum: Zur Rezeption avantgardistischer Kunst in Deutschland 1905-1933, Köln u. a. 1992, S. 256.
Stefan Pucks, "Eine weichliche, leidende, dem Beruf nicht genügende Natur? - Walther Rathenau im Spiegel der Kunst", in: Die Extreme berühren sich, Walther Rathenau 1867-1922, Berlin 1993, S. 83-98.
Magdalena M. Moeller, Max Pechstein. Sobre su curado Haff, in: Pechstein en Nidden 1909, Madrid 1999/2000, S. 14, SW-Abb. 1 (Detail).
Magdalena M. Moeller, Die großen Expressionisten: Meisterwerke und Künstlerleben, Köln 2000, S. 226.
Magdalena M. Moeller (Hrsg.), Max Pechsein im Brücke-Museum Berlin, München 2001, S. 12.
Christoph Otterbeck, Europa verlassen: Künstlerreisen am Beginn des 20. Jahrhunderts, Köln u. a. 2007, S. 238.
Anna Teut, Bürgerlich königlich: Walther Rathenau und Freienwalde, Berlin 2007, S. 51 (m. Abb.).
Aya Soika, Max Pechstein, der "Führer" der Brücke: Anmerkungen zur zeitgenössischen Rezeption, in: Brücke Archiv, 23/2008, hrsg. von Magdalena M. Moeller, München 2008, S. 80.
Magdalena M. Moeller, Max Pechstein in Nidden. Zu seinem Gemälde Haff, in: Neue Forschungen und Berichte, Brücke-Archiv, Heft 23/2008, S. 68 (m. Abb. 4).
Lothar Gall, Walter Rathenau: Portrait einer Epoche, München 2009, S. 72.
ARCHIVALIEN:
Inventarkarte der Walther-Rathenau-Stiftung, Nr. 265 "Treppenhaus: Märzenschnee", ohne Datum, entstanden zw. Nov. 1932 und Mai 1933, in: Bundesarchiv Berlin, Sign. R 1501/ 125243.
Auflistung der Versteigerungsaufträge in den Jahren 1935/36, in: Entschädigungsakte Edith Andreae, Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Berlin, Reg.-Nr. 52.178.
"Ich hätte Ihr liebes Schreiben schon eher beantwortet, wenn ich nicht gerade jetzt den Schnee noch malen wollte."
Hermann Max Pechstein an Rosa Schapire am 19. März 1909.
Öl auf Leinwand.
Rechts unten monogrammiert und datiert. 55 x 51 cm (21,6 x 20 in).
• 1909: kraftvoll leuchtende Landschaft aus der Berliner "Brücke"-Zeit.
• 1909: Mit diesem Gemälde gelingt Pechstein erstmals die Teilnahme an der Frühjahrsausstellung der Berliner Secession, die ihm zu seinem künstlerischen Durchbruch verhilft.
• 1909: Walther Rathenau, späterer Reichsaußenminister (1922), erwirbt diese Arbeit für seine private Kunstsammlung.
• Ein vergleichbares Gemälde befindet sich in den Kunstsammlungen Chemnitz, ein weiteres gilt als verschollen.
• Max Pechstein ist von der gleißenden Märzsonne und ihren Reflexen im Frühjahrsschnee gefangen.
• Was in dieser Zeit entsteht, ist wegweisend für Pechsteins expressionistische Malweise, die 1910 ihren Höhepunkt erreicht.
PROVENIENZ: Walther Rathenau (Berliner Secession 1909).
Nachlass Rathenau (1922/23).
Walther-Rathenau-Stiftung (1923-1934).
Fritz und Edith Andreae, geb. Rathenau (1934-1936).
Privatbesitz Nordrhein-Westfalen (wohl Ende der 1950er Jahre erworben in der Galerie Großhennig).
Seither in Familienbesitz.
Gütliche Einigung des Vorgenannten mit den Erben von Fritz und Edith Andreae (2025).
Wir danken Anna B. Rubin, HCPO New York, und Wolfgang Andreae, Walther Rathenau Gesellschaft e. V., für die freundliche Unterstützung.
AUSSTELLUNG: Internationale Kunstausstellung 1909, Berliner Secession, Berlin, 1909, Kat.-Nr. 195 (hier: Märzenschnee) (verso auf dem Keilrahmen mit einem Etikett).
Walther Rathenau 1867-1922. Die Extreme berühren sich, Deutsches Historisches Museum, Berlin, 9.12.1993-8.2.1994, Kat.-Nr. 2/33, Farbabb. S. 302.
Max Pechstein. Sein malerisches Werk, Brücke-Museum Berlin / Kunsthalle Tübingen / Kunsthalle Kiel, 1996/97, Kat.-Nr. 13 (m. Farbabb.) (hier: "Märzenschnee III").
Im Farbenrausch. Munch, Matisse und die Expressionisten, Museum Folkwang, Essen, 29.9.2012-13.1.2013, Kat.-Nr. 126, Farbabb. S. 238.
LITERATUR: Aya Soika, Max Pechstein. Das Werkverzeichnis der Ölgemälde, Bd. 1: 1905-1918, München 2011, WVZ-Nr. 1909/7 (m. Farbabb.).
- -
Auktionshaus Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal, Berlin, 13.6.1936, Los 518 (hier: "Der Bahndamm").
Leopold Reidemeister (Hrsg.), Max Pechstein. Erinnerungen, Wiesbaden 1960, S. 34.
Edwin Redslob, Von Weimar nach Europa. Erlebtes und Durchdachtes, Berlin 1972, S. 185.
Leopold Reidemeister, Das Brücke-Museum, Berlin 1984, S. 48.
Henrike Junge-Gent, Avantgarde und Publikum: Zur Rezeption avantgardistischer Kunst in Deutschland 1905-1933, Köln u. a. 1992, S. 256.
Stefan Pucks, "Eine weichliche, leidende, dem Beruf nicht genügende Natur? - Walther Rathenau im Spiegel der Kunst", in: Die Extreme berühren sich, Walther Rathenau 1867-1922, Berlin 1993, S. 83-98.
Magdalena M. Moeller, Max Pechstein. Sobre su curado Haff, in: Pechstein en Nidden 1909, Madrid 1999/2000, S. 14, SW-Abb. 1 (Detail).
Magdalena M. Moeller, Die großen Expressionisten: Meisterwerke und Künstlerleben, Köln 2000, S. 226.
Magdalena M. Moeller (Hrsg.), Max Pechsein im Brücke-Museum Berlin, München 2001, S. 12.
Christoph Otterbeck, Europa verlassen: Künstlerreisen am Beginn des 20. Jahrhunderts, Köln u. a. 2007, S. 238.
Anna Teut, Bürgerlich königlich: Walther Rathenau und Freienwalde, Berlin 2007, S. 51 (m. Abb.).
Aya Soika, Max Pechstein, der "Führer" der Brücke: Anmerkungen zur zeitgenössischen Rezeption, in: Brücke Archiv, 23/2008, hrsg. von Magdalena M. Moeller, München 2008, S. 80.
Magdalena M. Moeller, Max Pechstein in Nidden. Zu seinem Gemälde Haff, in: Neue Forschungen und Berichte, Brücke-Archiv, Heft 23/2008, S. 68 (m. Abb. 4).
Lothar Gall, Walter Rathenau: Portrait einer Epoche, München 2009, S. 72.
ARCHIVALIEN:
Inventarkarte der Walther-Rathenau-Stiftung, Nr. 265 "Treppenhaus: Märzenschnee", ohne Datum, entstanden zw. Nov. 1932 und Mai 1933, in: Bundesarchiv Berlin, Sign. R 1501/ 125243.
Auflistung der Versteigerungsaufträge in den Jahren 1935/36, in: Entschädigungsakte Edith Andreae, Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Berlin, Reg.-Nr. 52.178.
"Ich hätte Ihr liebes Schreiben schon eher beantwortet, wenn ich nicht gerade jetzt den Schnee noch malen wollte."
Hermann Max Pechstein an Rosa Schapire am 19. März 1909.
Hermann Max Pechsteins "Märzenschnee" – Ein Meisterwerk des deutschen Expressionismus
Schon im Entstehungsjahr ist dieses Gemälde auf der Internationalen Kunstausstellung der Berliner Secession ausgestellt. Schon am ersten Tag kann Pechstein dieses Gemälde für 300 Reichsmark verkaufen. Der erste Besitzer dieses Werkes war kein Geringerer als Walther Rathenau. Der liberale Intellektuelle, Industrielle und spätere Außenminister der Weimarer Republik war nicht nur politisch ein Pionier, sondern auch ein leidenschaftlicher Kunstmäzen. Er erwirbt "Märzenschnee" 1909 direkt aus der Ausstellung der Berliner Secession – ein Zeugnis seines Engagements für aufstrebende Künstler wie Pechstein.
Dieser Verkauf ermöglicht es dem Künstler, "einen seit langem gehegten Wunsch in die Tat umzusetzen und den Sommer am Meer zu verbringen, um sich 'ganz seinem freien Schaffen hinzugeben'" (zit. nach: M. Moeller, in: Ausst.-Kat. Berlin/Tübingen/Kiel 1996/97, S. 14). Er wird Nidden für diesen ausgedehnten Sommeraufenthalt wählen, wo einige seiner bedeutendsten Bilder entstehen. Unser "Märzenschnee: Der Bahndamm" zeigt in gleißender Helligkeit den besonderen Eindruck eines späten Wintereinbruchs. Pechstein geht in diesem Gemälde weit über die impressionistischen Sehweisen hinaus. Wie beeindruckend die Wirkung von Pechsteins Arbeiten von Anfang 1909 im Vergleich zu Werken anderer Künstler außerhalb der "Brücke"-Gemeinschaft gewesen sein muss, wird anhand einer Erinnerung des Künstlers deutlich. So schreibt er im Rückblick auf die Ausstellung der Berliner Secession: "Am Eröffnungstag durchfuhr mich selbst ein Schreck, als ich feststellen mußte, wie stark und eindeutig meine Formensprache gegenüber dem Impressionismus sich Geltung erzwang" (Max Pechstein, Erinnerungen, Stuttgart 1993, S. 33f.). Und ein weiteres Zeugnis aus der Feder des Künstlers, ein Brief an Rosa Schapire, zeigt, mit welcher Spontanität und inneren Notwendigkeit er die Besonderheit der Lichtstimmung des späten Schnees im Frühjahr festhalten wollte: "Ich hätte ihr liebes Schreiben schon eher beantwortet, wenn ich nicht gerade jetzt den Schnee noch malen wollte, und nun kamen noch einige Sonnenuntergänge hinzu, welche mich ganz erschöpften, malen konnte ich dieselben leider nicht, weil die 3 Schneelandschaften meine Farben aufgebraucht, [... mir] wurde noch vom Herrn Bahnmeister bedeutet, daß ich den Bahndamm verlassen müßte, da ich glücklich ziemlich fertig geworden fügte ich mich dem freundlichen Zureden diese Herrn." Im Hintergrund kommt schon die Dampflok angebraust und sie dampft ihre hellblauen Wolken mächtig in den Himmel. Noch zwei weitere "Schneebilder" hat er unter diesem Eindruck gemalt, das eine, "Schmelzender Märzenschnee" (Soika 1909/6), gilt als verschollen, das andere, "Märzenschnee" (Soika 1909/6), ist im Besitz der Kunstsammlung Chemnitz (Inv.-Nr. 800).
Hermann Max Pechsteins "Märzenschnee" – Ein Zeugnis deutscher Geschichte
Nach Rathenaus Ermordung im Jahr 1922 ging das Gemälde in den Besitz seiner Familie über. Seine Schwester Edith Andreae, eine zentrale Figur der Berliner Salonkultur, verwaltete gemeinsam mit ihrer Mutter Mathilde Rathenau den umfangreichen Nachlass. In enger Zusammenarbeit mit dem Staat gründeten sie 1923 die Walther-Rathenau-Stiftung, der das ehemalige Wohnhaus in der Königsallee 65 in Grunewald mitsamt Inventar – darunter auch dieses Gemälde – übertragen wurde.
Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das Andenken an Rathenau systematisch ausgelöscht. Die Stiftung wurde 1934 aufgelöst, der Staat trat von der Schenkung zurück und das Haus mit dem Gemälde "Märzenschnee" ging zurück in das Eigentum der Familie Andreae.
1936 schließlich – unter dem zunehmenden Druck nationalsozialistischer Repression – musste die Familie Andreae einen Teil ihres Besitzes veräußern. Am 13. Juni 1936 kamen beim Berliner Auktionshaus Mandelbaum & Kronthal rund 50 Objekte aus dem Besitz der Familie Andreae zur Versteigerung – darunter auch Märzenschnee, das mit einem symbolischen Ausrufpreis von 30 Reichsmark aufgerufen wurde.
Das Werk ist frei von Restitutionsansprüchen. Das Angebot erfolgt in freundlichem Einvernehmen mit den Erben nach Fritz und Edith Andreae auf Grundlage einer gerechten und fairen Lösung.
Schon im Entstehungsjahr ist dieses Gemälde auf der Internationalen Kunstausstellung der Berliner Secession ausgestellt. Schon am ersten Tag kann Pechstein dieses Gemälde für 300 Reichsmark verkaufen. Der erste Besitzer dieses Werkes war kein Geringerer als Walther Rathenau. Der liberale Intellektuelle, Industrielle und spätere Außenminister der Weimarer Republik war nicht nur politisch ein Pionier, sondern auch ein leidenschaftlicher Kunstmäzen. Er erwirbt "Märzenschnee" 1909 direkt aus der Ausstellung der Berliner Secession – ein Zeugnis seines Engagements für aufstrebende Künstler wie Pechstein.
Dieser Verkauf ermöglicht es dem Künstler, "einen seit langem gehegten Wunsch in die Tat umzusetzen und den Sommer am Meer zu verbringen, um sich 'ganz seinem freien Schaffen hinzugeben'" (zit. nach: M. Moeller, in: Ausst.-Kat. Berlin/Tübingen/Kiel 1996/97, S. 14). Er wird Nidden für diesen ausgedehnten Sommeraufenthalt wählen, wo einige seiner bedeutendsten Bilder entstehen. Unser "Märzenschnee: Der Bahndamm" zeigt in gleißender Helligkeit den besonderen Eindruck eines späten Wintereinbruchs. Pechstein geht in diesem Gemälde weit über die impressionistischen Sehweisen hinaus. Wie beeindruckend die Wirkung von Pechsteins Arbeiten von Anfang 1909 im Vergleich zu Werken anderer Künstler außerhalb der "Brücke"-Gemeinschaft gewesen sein muss, wird anhand einer Erinnerung des Künstlers deutlich. So schreibt er im Rückblick auf die Ausstellung der Berliner Secession: "Am Eröffnungstag durchfuhr mich selbst ein Schreck, als ich feststellen mußte, wie stark und eindeutig meine Formensprache gegenüber dem Impressionismus sich Geltung erzwang" (Max Pechstein, Erinnerungen, Stuttgart 1993, S. 33f.). Und ein weiteres Zeugnis aus der Feder des Künstlers, ein Brief an Rosa Schapire, zeigt, mit welcher Spontanität und inneren Notwendigkeit er die Besonderheit der Lichtstimmung des späten Schnees im Frühjahr festhalten wollte: "Ich hätte ihr liebes Schreiben schon eher beantwortet, wenn ich nicht gerade jetzt den Schnee noch malen wollte, und nun kamen noch einige Sonnenuntergänge hinzu, welche mich ganz erschöpften, malen konnte ich dieselben leider nicht, weil die 3 Schneelandschaften meine Farben aufgebraucht, [... mir] wurde noch vom Herrn Bahnmeister bedeutet, daß ich den Bahndamm verlassen müßte, da ich glücklich ziemlich fertig geworden fügte ich mich dem freundlichen Zureden diese Herrn." Im Hintergrund kommt schon die Dampflok angebraust und sie dampft ihre hellblauen Wolken mächtig in den Himmel. Noch zwei weitere "Schneebilder" hat er unter diesem Eindruck gemalt, das eine, "Schmelzender Märzenschnee" (Soika 1909/6), gilt als verschollen, das andere, "Märzenschnee" (Soika 1909/6), ist im Besitz der Kunstsammlung Chemnitz (Inv.-Nr. 800).
Hermann Max Pechsteins "Märzenschnee" – Ein Zeugnis deutscher Geschichte
Nach Rathenaus Ermordung im Jahr 1922 ging das Gemälde in den Besitz seiner Familie über. Seine Schwester Edith Andreae, eine zentrale Figur der Berliner Salonkultur, verwaltete gemeinsam mit ihrer Mutter Mathilde Rathenau den umfangreichen Nachlass. In enger Zusammenarbeit mit dem Staat gründeten sie 1923 die Walther-Rathenau-Stiftung, der das ehemalige Wohnhaus in der Königsallee 65 in Grunewald mitsamt Inventar – darunter auch dieses Gemälde – übertragen wurde.
Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde das Andenken an Rathenau systematisch ausgelöscht. Die Stiftung wurde 1934 aufgelöst, der Staat trat von der Schenkung zurück und das Haus mit dem Gemälde "Märzenschnee" ging zurück in das Eigentum der Familie Andreae.
1936 schließlich – unter dem zunehmenden Druck nationalsozialistischer Repression – musste die Familie Andreae einen Teil ihres Besitzes veräußern. Am 13. Juni 1936 kamen beim Berliner Auktionshaus Mandelbaum & Kronthal rund 50 Objekte aus dem Besitz der Familie Andreae zur Versteigerung – darunter auch Märzenschnee, das mit einem symbolischen Ausrufpreis von 30 Reichsmark aufgerufen wurde.
Das Werk ist frei von Restitutionsansprüchen. Das Angebot erfolgt in freundlichem Einvernehmen mit den Erben nach Fritz und Edith Andreae auf Grundlage einer gerechten und fairen Lösung.
124001375
Hermann Max Pechstein
Märzenschnee: Der Bahndamm, 1909.
Öl auf Leinwand
Schätzpreis: € 200.000 - 300.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Christoph Calaminus
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.