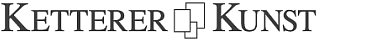Auktion: 590 / Evening Sale am 06.06.2025 in München  Lot 125000601
Lot 125000601
 Lot 125000601
Lot 125000601
125000601
Edvard Munch
Das rote Haus (Det røde hus), 1926.
Öl auf Leinwand
Schätzpreis: € 1.200.000 - 1.800.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Das rote Haus (Det røde hus). 1926.
Öl auf Leinwand.
110 x 130 cm (43,3 x 51,1 in).
Dargestellt ist das rote Haus, das sich als Nebengebäude auf dem von Munch 1916 erworbenen Gut Ekely bei Oslo befand, welches Munch bis zu seinem Tod im Jahr 1944 bewohnt. [JS].
• Edvard Munch zählt aufgrund seiner revolutionären Seelenmalerei neben Vincent van Gogh und Henri Matisse zu den Pionieren der europäischen Moderne.
• Die emotionale Kraft der Natur ist Munchs zentrales Thema: "Ich fühlte, dass ein unendlicher Schrei durch die Natur ging." (Edvard Munch zur Entstehung von "Der Schrei").
• Weit, bewegt, zerfurcht und kraftvoll: "Das rote Haus" als Munchs persönliche Seelenlandschaft und Sinnbild des Lebens.
• Magische Lichtstimmung: meisterliche Inszenierung der nordischen Landschaft, des Gefühls von Weite und gläsernem Licht.
• Entstanden auf Gut Ekely bei Oslo: seit 1916 Rückzugsort und schöpferischer Mittelpunkt des einsamen Künstlers.
• Auf dem Höhepunkt: Im Entstehungsjahr wählt Munch "Das rote Haus" für die Munch-Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim und ein Jahr später für die große Munch-Retrospektive in der Nationalgalerie Berlin aus.
• Bereits 1927/28 aus der Galerie Ernst Arnold, Dresden, in die wichtige Expressionismus-Sammlung Max Glaeser, aus der wir zuletzt Kirchners "Tanz im Varieté" erfolgreich veräußern konnten.
• Von größter Seltenheit: erstes Munch-Gemälde auf dem deutschen Auktionsmarkt (Quelle: artprice.com).
PROVENIENZ: Sammlung Max Glaeser (1871-1931), Kaiserslautern-Eselsfürth (1927 vom Künstler durch Vermittlung der Galerie Arnold, Dresden, erworben).
Sammlung Anna Glaeser, geb. Opp (1864-1944), Kaiserslautern-Eselsfürth (1931 durch Erbschaft vom Vorgenannten, bis mindestens Dezember 1935, bis spätestens Januar 1937).
Galerie Neue Kunst Fides, Dresden (um 1936/37 vom Vorgenannten).
Sammlung Friedrich Karl Schenck, Sattelmühle (höchstwahrscheinlich um 1937 vom Vorgenannten erworben, bis 1964: Galerie Wolfgang Ketterer).
Sammlung Sigval Bergesen d.J., Oslo (vom Vorgenannten, seit 1964: Galerie Wolfgang Ketterer).
Seither in Familienbesitz.
AUSSTELLUNG: Efteraarsudstillingen, Kopenhagen, Oktober 1926 (laut: 1988 Sommernacht Mannheim, S. 288. [[[Katalog nicht gefunden!]]] Besprechung: https://doi.org/10.11588/diglit.29340#029, kein Kat gefunden).
Edvard Munch, Gemälde und Graphik, Kunsthalle Mannheim, Mannheim 1926, Kat.-Nr. 71 (Besitznachweis Edvard Munch), m. Abb. S. 23.
Edvard Munch, Nationalgalerie, Berlin 1927, Kat.-Nr. 219 (Besitznachweis Edvard Munch), m. Abb. S. 45.
Edvard Munch, Galerie Ernst Arnold, Dresden 1927.
100. Ausstellung der Kestner-Gesellschaft Hannover, Kestner-Gesellschaft, Hannover, 1929.
Edvard Munch, Kunsthütte Chemnitz, 1929, Kat.-Nr. 59 (mit Besitznachweis "Kommerzienrath Gläser, Eselsfürth b. Kaiserslautern"), Abb. S. 40.
Edvard Munch Paul Gauguin, Kunsthaus Zürich, Zürich 1932, Kat.-Nr. 36.
Edvard Munch, Nagoya. National museum Of Modern art, Kyoto, Wanderausstellung (ferner Osaka, Nara und Shiuga), 1970/71, Kat.-Nr. 32, Abb. S. 53.
Edvard Munch in Chemnitz, Städtische Kunstsammlungen, Chemnitz, 1999/2000, Kat.-Nr. 60, Abb. S. 103 und 246 (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett).
Gjennom nature (Trough the nature), Munchmuseet Oslo, 2014/15, ohne Katalog.
LITERATUR: Gerd Woll, Edvard Munch Complete Paintings Catalogue Raisonné, Volume IV, Oslo 2009, Nr. 1571, m. Abb. S. 1430.
- -
Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe\\~— 25.1927, Heft 4, S. 154 (Abb.) (https://doi.org/10.11588/diglit.7392#0178).
Alfred Kuhn, Edvard Munch und der Geist seiner Zeit. Anlässlich der grossen Munch-Ausstellung der Nationalgalerie zu Berlin, in: Der Cicerone, Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers, 19.1927, Heft 5, S. 139-147 (m. Abb. S. 146) (https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0168).
Edvard Munch, Ausst.-Kat. Nasjonalgalleriet Oslo 1927, Kat.-Nr. 271, Abb. S. 55 (nicht ausgestellt).
Edmund Hausen: Die Sammlung Glaeser, in: Hand und Maschine. Mitteilungsblatt der Pfälzischen Landesgewerbeanstalt, 1929, H. 1, S. 105-124, Abb. S. 110, 111, 120.
Die Sammlung Max Glaeser, Eselsfürth, in: Der Sammler 1930, Heft 2, S. 26f. (m. Abb. in situ).
Adolf Schinnerer, Zu den Bildern von Edvard Munch, in: Die Kunst für Alle, Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, 50.1934-1935, S. 109 (Abb., mit dem Titel "Winterlandschaft") (https://doi.org/10.11588/diglit.16482#0122).
Josef Paul Hodin, Edvard Munch. Der Genius Der Nordens, Stockholm 1948, S. 137, m. Abb. 99.
Galerie Wolfgang Ketterer, Lagerkatalog Nr. 29, 1963, Tafel 7.
Galerie Wolfgang Ketterer, Lagerkatalog Nr. 30, 1964, Kast.-Nr. 975, Tafel 7.
Die Weltkunst, XXXIV. Jahrgang, Nr. 7, 1.4.1964, Titel (Farbabb.)
"Fast ein Auktionskatalog", Handelsblatt, 17./18.1.1964.
Johan Langaard, Edvard Munch i familien Sigval Bergesen D. Y's eie, Oslo 1967, S. 80 (m. Abb. S. 81).
[[[[Was ist mit dem 2. Katalog von 1971?]]]]]
Pfalzgalerie des Bezirksverbandes, Katalog der Gemälde und Plastiken des 19. und 20. Jahrhunderts, Kaiserslautern 1975 (m. Abb., o. S.).
Ragna Stang, Edvard Munch mennesket og kunstneren, Oslo 1979, S. 268, Abb. 343.
Städtische Kunsthalle, Mannheim, Edvard Munch, Sommernacht am Oslofjord um 1990 (Kunst und Dokumentation. 12), Mannheim 1988, S. 269, m. Abb., S. 288.
Arne Eggum, Munch og Ekely, Munch-museet Oslo 1998, S. 79.
Daniela Christmann, Die Moderne in der Pfalz: Künstlerische Beiträge, Künstlervereinigung und Kunstförderung in den zwanziger Jahren, Heidelberg 1999, S. 281.
Ulrike Saß, Die Galerie Gerstenberger und Wilhelm Grosshennig. Kunsthandel in Deutschland von der Kaiserzeit zur BRD, Wien/Köln/Weimar 2021, S. 296f. (m. Abb. 64).
ARCHIVALIEN:
Briefwechsel Edvard Munch mit Max Glaeser, Galerie Arnold, Verlag Piper, 1927-1929, Archiv des Munchmuseet Oslo, MM K 3733, MM K 3734, MM N 2217, MM K 3985, MM N 3348 u.a.
Dokumentation zur Ausstellung 1927 in der Galerie Arnold, Dresden, Nachlass Gutbier/Galerie Arnold, Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, I B 184.
Künzig, Dr. Brunner, Dr. Koehler Rechtsanwälte, Mannheim (Nachlassverwaltung Glaeser): Angebot von Gemälden aus Sammlung Max Glaeser, 1931, Archiv des Kunstmuseums Basel, Signatur F 001.024.010.000.
Galerie Buck, Mannheim: Angebot Gemälde u. a. von Arnold Böcklin, Lovis Corinth, Anselm Feuerbach, Ernst Ludwig Kirchner, Hans von Marées, Edvard Munch, Heinrich von Zügel, Sammlung Max Glaeser, 1932, Archiv des Kunstmuseums Basel, Signatur F 001.025.002.000.
Galerie Buck, Mannheim: Angebot Gemälde, 4.7.1932, Stadtarchiv Düsseldorf, Bestand: 0-1-4 Stadtverwaltung Düsseldorf von 1933-2000 (alt: Bestand IV), Angebote und Ankäufe, Sign. 3769.0000, fol. 175-177.
Nachlass der Galerie Heinemann, DKA Nürnberg, Kartei angebotene Bilder, Dez. 1935, KA-M-396 (http://heinemann.gnm.de/de/kunstwerk-43959.htm).
Sammlungsschätzung für Friedrich Schenck, 1942, Nachlass Rudolf Probst im Archiv der Avantgarden - Egidio Marzona, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, A5139-V024-01.
Schreiben Deutsche Bank Kaiserslautern an Rudolf Probst, 7.11.1936, Nachlass Rudolf Probst im Archiv der Avantgarden - Egidio Marzona, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, A3377-V019-01.
"In meiner Kunst habe ich versucht, mir das Leben und seinen Sinn zu erklären."
Edvard Munch
"Munch poses a question that he would pursue until his death in 1944: To what extent can artists convey their innermost thoughts and feelings using lines, forms, and colors?"
Annemarie Iker, 2020, Museum of Modern Art, New York.
Öl auf Leinwand.
110 x 130 cm (43,3 x 51,1 in).
Dargestellt ist das rote Haus, das sich als Nebengebäude auf dem von Munch 1916 erworbenen Gut Ekely bei Oslo befand, welches Munch bis zu seinem Tod im Jahr 1944 bewohnt. [JS].
• Edvard Munch zählt aufgrund seiner revolutionären Seelenmalerei neben Vincent van Gogh und Henri Matisse zu den Pionieren der europäischen Moderne.
• Die emotionale Kraft der Natur ist Munchs zentrales Thema: "Ich fühlte, dass ein unendlicher Schrei durch die Natur ging." (Edvard Munch zur Entstehung von "Der Schrei").
• Weit, bewegt, zerfurcht und kraftvoll: "Das rote Haus" als Munchs persönliche Seelenlandschaft und Sinnbild des Lebens.
• Magische Lichtstimmung: meisterliche Inszenierung der nordischen Landschaft, des Gefühls von Weite und gläsernem Licht.
• Entstanden auf Gut Ekely bei Oslo: seit 1916 Rückzugsort und schöpferischer Mittelpunkt des einsamen Künstlers.
• Auf dem Höhepunkt: Im Entstehungsjahr wählt Munch "Das rote Haus" für die Munch-Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim und ein Jahr später für die große Munch-Retrospektive in der Nationalgalerie Berlin aus.
• Bereits 1927/28 aus der Galerie Ernst Arnold, Dresden, in die wichtige Expressionismus-Sammlung Max Glaeser, aus der wir zuletzt Kirchners "Tanz im Varieté" erfolgreich veräußern konnten.
• Von größter Seltenheit: erstes Munch-Gemälde auf dem deutschen Auktionsmarkt (Quelle: artprice.com).
PROVENIENZ: Sammlung Max Glaeser (1871-1931), Kaiserslautern-Eselsfürth (1927 vom Künstler durch Vermittlung der Galerie Arnold, Dresden, erworben).
Sammlung Anna Glaeser, geb. Opp (1864-1944), Kaiserslautern-Eselsfürth (1931 durch Erbschaft vom Vorgenannten, bis mindestens Dezember 1935, bis spätestens Januar 1937).
Galerie Neue Kunst Fides, Dresden (um 1936/37 vom Vorgenannten).
Sammlung Friedrich Karl Schenck, Sattelmühle (höchstwahrscheinlich um 1937 vom Vorgenannten erworben, bis 1964: Galerie Wolfgang Ketterer).
Sammlung Sigval Bergesen d.J., Oslo (vom Vorgenannten, seit 1964: Galerie Wolfgang Ketterer).
Seither in Familienbesitz.
AUSSTELLUNG: Efteraarsudstillingen, Kopenhagen, Oktober 1926 (laut: 1988 Sommernacht Mannheim, S. 288. [[[Katalog nicht gefunden!]]] Besprechung: https://doi.org/10.11588/diglit.29340#029, kein Kat gefunden).
Edvard Munch, Gemälde und Graphik, Kunsthalle Mannheim, Mannheim 1926, Kat.-Nr. 71 (Besitznachweis Edvard Munch), m. Abb. S. 23.
Edvard Munch, Nationalgalerie, Berlin 1927, Kat.-Nr. 219 (Besitznachweis Edvard Munch), m. Abb. S. 45.
Edvard Munch, Galerie Ernst Arnold, Dresden 1927.
100. Ausstellung der Kestner-Gesellschaft Hannover, Kestner-Gesellschaft, Hannover, 1929.
Edvard Munch, Kunsthütte Chemnitz, 1929, Kat.-Nr. 59 (mit Besitznachweis "Kommerzienrath Gläser, Eselsfürth b. Kaiserslautern"), Abb. S. 40.
Edvard Munch Paul Gauguin, Kunsthaus Zürich, Zürich 1932, Kat.-Nr. 36.
Edvard Munch, Nagoya. National museum Of Modern art, Kyoto, Wanderausstellung (ferner Osaka, Nara und Shiuga), 1970/71, Kat.-Nr. 32, Abb. S. 53.
Edvard Munch in Chemnitz, Städtische Kunstsammlungen, Chemnitz, 1999/2000, Kat.-Nr. 60, Abb. S. 103 und 246 (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett).
Gjennom nature (Trough the nature), Munchmuseet Oslo, 2014/15, ohne Katalog.
LITERATUR: Gerd Woll, Edvard Munch Complete Paintings Catalogue Raisonné, Volume IV, Oslo 2009, Nr. 1571, m. Abb. S. 1430.
- -
Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe\\~— 25.1927, Heft 4, S. 154 (Abb.) (https://doi.org/10.11588/diglit.7392#0178).
Alfred Kuhn, Edvard Munch und der Geist seiner Zeit. Anlässlich der grossen Munch-Ausstellung der Nationalgalerie zu Berlin, in: Der Cicerone, Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers, 19.1927, Heft 5, S. 139-147 (m. Abb. S. 146) (https://doi.org/10.11588/diglit.39946#0168).
Edvard Munch, Ausst.-Kat. Nasjonalgalleriet Oslo 1927, Kat.-Nr. 271, Abb. S. 55 (nicht ausgestellt).
Edmund Hausen: Die Sammlung Glaeser, in: Hand und Maschine. Mitteilungsblatt der Pfälzischen Landesgewerbeanstalt, 1929, H. 1, S. 105-124, Abb. S. 110, 111, 120.
Die Sammlung Max Glaeser, Eselsfürth, in: Der Sammler 1930, Heft 2, S. 26f. (m. Abb. in situ).
Adolf Schinnerer, Zu den Bildern von Edvard Munch, in: Die Kunst für Alle, Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, 50.1934-1935, S. 109 (Abb., mit dem Titel "Winterlandschaft") (https://doi.org/10.11588/diglit.16482#0122).
Josef Paul Hodin, Edvard Munch. Der Genius Der Nordens, Stockholm 1948, S. 137, m. Abb. 99.
Galerie Wolfgang Ketterer, Lagerkatalog Nr. 29, 1963, Tafel 7.
Galerie Wolfgang Ketterer, Lagerkatalog Nr. 30, 1964, Kast.-Nr. 975, Tafel 7.
Die Weltkunst, XXXIV. Jahrgang, Nr. 7, 1.4.1964, Titel (Farbabb.)
"Fast ein Auktionskatalog", Handelsblatt, 17./18.1.1964.
Johan Langaard, Edvard Munch i familien Sigval Bergesen D. Y's eie, Oslo 1967, S. 80 (m. Abb. S. 81).
[[[[Was ist mit dem 2. Katalog von 1971?]]]]]
Pfalzgalerie des Bezirksverbandes, Katalog der Gemälde und Plastiken des 19. und 20. Jahrhunderts, Kaiserslautern 1975 (m. Abb., o. S.).
Ragna Stang, Edvard Munch mennesket og kunstneren, Oslo 1979, S. 268, Abb. 343.
Städtische Kunsthalle, Mannheim, Edvard Munch, Sommernacht am Oslofjord um 1990 (Kunst und Dokumentation. 12), Mannheim 1988, S. 269, m. Abb., S. 288.
Arne Eggum, Munch og Ekely, Munch-museet Oslo 1998, S. 79.
Daniela Christmann, Die Moderne in der Pfalz: Künstlerische Beiträge, Künstlervereinigung und Kunstförderung in den zwanziger Jahren, Heidelberg 1999, S. 281.
Ulrike Saß, Die Galerie Gerstenberger und Wilhelm Grosshennig. Kunsthandel in Deutschland von der Kaiserzeit zur BRD, Wien/Köln/Weimar 2021, S. 296f. (m. Abb. 64).
ARCHIVALIEN:
Briefwechsel Edvard Munch mit Max Glaeser, Galerie Arnold, Verlag Piper, 1927-1929, Archiv des Munchmuseet Oslo, MM K 3733, MM K 3734, MM N 2217, MM K 3985, MM N 3348 u.a.
Dokumentation zur Ausstellung 1927 in der Galerie Arnold, Dresden, Nachlass Gutbier/Galerie Arnold, Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, I B 184.
Künzig, Dr. Brunner, Dr. Koehler Rechtsanwälte, Mannheim (Nachlassverwaltung Glaeser): Angebot von Gemälden aus Sammlung Max Glaeser, 1931, Archiv des Kunstmuseums Basel, Signatur F 001.024.010.000.
Galerie Buck, Mannheim: Angebot Gemälde u. a. von Arnold Böcklin, Lovis Corinth, Anselm Feuerbach, Ernst Ludwig Kirchner, Hans von Marées, Edvard Munch, Heinrich von Zügel, Sammlung Max Glaeser, 1932, Archiv des Kunstmuseums Basel, Signatur F 001.025.002.000.
Galerie Buck, Mannheim: Angebot Gemälde, 4.7.1932, Stadtarchiv Düsseldorf, Bestand: 0-1-4 Stadtverwaltung Düsseldorf von 1933-2000 (alt: Bestand IV), Angebote und Ankäufe, Sign. 3769.0000, fol. 175-177.
Nachlass der Galerie Heinemann, DKA Nürnberg, Kartei angebotene Bilder, Dez. 1935, KA-M-396 (http://heinemann.gnm.de/de/kunstwerk-43959.htm).
Sammlungsschätzung für Friedrich Schenck, 1942, Nachlass Rudolf Probst im Archiv der Avantgarden - Egidio Marzona, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, A5139-V024-01.
Schreiben Deutsche Bank Kaiserslautern an Rudolf Probst, 7.11.1936, Nachlass Rudolf Probst im Archiv der Avantgarden - Egidio Marzona, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, A3377-V019-01.
"In meiner Kunst habe ich versucht, mir das Leben und seinen Sinn zu erklären."
Edvard Munch
"Munch poses a question that he would pursue until his death in 1944: To what extent can artists convey their innermost thoughts and feelings using lines, forms, and colors?"
Annemarie Iker, 2020, Museum of Modern Art, New York.
Edvard Munch – Pionier der europäischen Moderne
Edvard Munch zählt neben Vincent van Gogh und Henri Matisse zu den Pionieren der europäischen Moderne. Ohne sie und ihren mutigen Erneuerungsdrang wäre der Expressionismus, allem voran die Malerei der "Brücke" und des "Blauen Reiter" nicht möglich gewesen. Sie sind die treibenden Kräfte, die bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der die späteren europäischen Kunstmetropolen Berlin und Paris noch von der klassischen Salon- und Historienmalerei dominiert sind, radikal Neues erproben. Die Malerei des jungen Norwegers Edvard Munch schlägt 1892 in Berlin ein wie ein Meteorid. Bereits nach wenigen Tagen wird seine auf Einladung des Vereins Berliner Künstler veranstaltete Ausstellung auf Betreiben Anton von Werners, des Direktors der Königlichen Hochschule der Bildenden Künste, begleitet von Protesten und Handgreiflichkeiten unter den Vereinsmitgliedern geschlossen. Aber der Skandal um Munchs vollkommen neuartige, als roh und unfertig empfundene Malerei hatte den konservativen Berliner Kunstbetrieb ein für alle mal wachgerüttelt. Munch löste in Berlin eine Art Urknall aus, der die wenige Jahre später vollzogene Gründung der Berliner Secession unter der Leitung Max Liebermanns und das schon kurz darauf einsetzende Aufkommen des Expressionismus erst möglich gemacht hat. Munchs Unangepasstheit, seine unfassbar emotionsgeladene und akademische Traditionen hinter sich lassende Malerei sollte fortan zu einer der wichtigsten Kräfte für die europäische Avantgarde werden.
Leben, Liebe, Angst und Tod – Munch als Meister der nordischen Seelenlandschaft
Es ist das emotional aufgeladene Naturempfinden des Menschen, das Munch selbst, nach impressionistischen Anfängen, als sein persönliches künstlerisches Erweckungserlebnis beschreibt und das für seine insgesamt vier, heute als ikonisch geltenden Gemäldeversionen von "Der Schrei" verantwortlich ist: "Ich ging die Straße hinunter mit zwei Freunden – als die Sonne unterging – der Himmel sich plötzlich blutrot färbte […] über dem blauschwarzen Fjord und der Stadt lagen Blut und Feuerzungen – [...] und ich, stand da zitternd vor Angst – und ich fühlte, daß ein unendlicher Schrei durch die Natur ging." Munch ist es durch die verzerrte, aber symbiotische Verbindung von Natur und Mensch erstmals gelungen, das existenzielle Gefühl der Angst auf die Leinwand zu bannen. Munch, dessen Kindheit bereits aufgrund des frühen Todes seiner Mutter und seiner geliebten Schwester Sophie durch qualvolle Erfahrungen geprägt war, ist fortan der Maler existenzieller Gefühlswelten zwischen Leben, Liebe, Angst und Tod. Dies sind die abstrakten aber menschheitsbeherrschenden Themenwelten, die Munch, der zudem mehrere unglückliche Liebesbeziehungen künstlerisch zu verarbeiten hatte, auch in den Gemälden seines berühmten "Lebensfrieses" zusammenfasst und lebenslang weiterentwickelt. Zu den berühmtesten Gemälden dieser Werkgruppe zählt "Der Tanz des Lebens" (1899/1900, Norwegische Nationalgalerie, Oslo), von welchem Munch ein Jahr vor unserem Gemälde eine zweite Version malt (1925, Munch Museet, Oslo). In einer norwegischen Fjordlandschaft zeigt Munch hier tanzende, das Leben, die Liebe und den Tod symbolisierende Figuren vor einer schwermütig hinter dem Meer versinkenden Sonne. Aber Munch, der Zeit seines Lebens psychisch und physisch stark angeschlagen ist und dennoch wie ein Wunder 1918 die verheerende Spanische Grippe überlebt, malt auch immer wieder menschenleere Stimmungslandschaften, die uns aufgrund der melancholisch-nervösen Veranlagung des hoch empfindsamen Malers stets als intime und bis heute fesselnde Seelenlandschaften des Künstlers gegenübertreten.
Weit, bewegt, zerfurcht und kraftvoll – "Das rote Haus" als Sinnbild des Lebens
Während des Ersten Weltkrieges erwirbt Munch, nach zahlreichen Auslandsreisen und seiner labilen Psyche geschuldeten Klinikaufenhalten, 1916 Gut Ekely nahe Oslo, das fortan zu seinem Rückzugsort und schöpferischem Mittelpunkt wird. Neben dem Haupt- und Atelierhaus, das der Künstler alleine bewohnt, befindet sich auf dem weitläufigen Gelände mit Blick Richtung Oslo sowie über Wiesen und Obstbäume auf die Weiten des Fjords auch das rote Haus, das Munch in unserem stimmungsvollen Gemälde in leuchtenden Farben und mit bewegtem Strich auf die großformatige Leinwand setzt. In "Das rote Haus" wird die vertraute Landschaft des einsamen Künstlers, einem gemalten Tagebucheintrag gleich, zur bewegten Seelenlandschaft gesteigert. "In meiner Kunst habe ich versucht, mir das Leben und seinen Sinn zu erklären." lautet ein berühmtes, seine künstlerische Motivation erläuterndes Zitat des norwegischen Malers. Geradezu magisch ist in "Das rote Haus" die eingefangene Stimmung, des Gefühls von unendlicher Weite und gläsernem Licht, wie es für die nordische Landschaft charakteristisch ist. Noch kahl ist das fein verzweigte Geäst des knorrigen Baumes zur Rechten, dem links ein kleiner junger, gerade heranwachsender Baum gegenübersteht. Stürmisch und weit ist der bewegte Himmel, regungslos das spiegelnde Wasser, bereit durch ein über Jahrzehnte geformtes Flussbett kraftvoll ins Meer zu stürzen und sich aufzulösen in der berauschenden Unendlichkeit. Es ist die für Munchs epochales Schaffen so zentrale und bedeutende Reflexion über die eigene Endlichkeit, die hier mitschwingt, das Bewusstsein für die Verwundbarkeit und Flüchtigkeit der eigenen Existenz in Anbetracht des ewigen Schauspiels der Natur. Ein Gedanke, wie er etwa auch bereits der romantischen Malerei Caspar David Friedrichs inhärent ist, wenn er seinen "Mönch am Meer" (1808/10) oder seinen "Wanderer über dem Nebelmeer" (1818) mit einem überwältigenden Naturschauspiel konfrontiert. Anders als Friedrich aber nutzt Munch die Darstellung der Natur nicht nur als Bildlichkeit des ewig Erhabenen, sondern vielmehr als ein Spiegelbild seiner eigenen Seelenverfassung, als geradezu rauschhaft niedergeschriebenen Versuch, dem eigenen, inneren Empfinden künstlerisch Ausdruck zu verleihen. Und so ist "Das rote Haus" mit seiner wild bewegten und zerfurchten Landschaft und dem gewaltigen, noch kahlen, aber bald wieder aufs Neue kraftvoll austreibenden Baum das Abbild einer reifen Künstlerpersönlichkeit, vom Leben gezeichnet, aber gerade deshalb empfindsam, kraftvoll und lebenshungrig. Munch selbst hat rückblickend einmal recht passend formuliert: "Ich möchte das Leiden nicht missen, wie viel verdanke ich doch in meiner Kunst dem Leiden?" und "Mein Durchbruch kam ja eigentlich sehr spät […]. Aber in dieser Zeit […] fühlte ich, dass ich Kraft genug besaß um etwas Neues zu schaffen [...]“ (Edvard Munch 1939, zit. nach: Ranga Stang, Edvard Munch, Königstein i. T. 1979, S. 258.)
"Das rote Haus" – Von Munch, Kuratoren und Sammlern hoch geschätzt
Wie von allen anderen Motivkomplexen, die Munch persönlich besonders am Herzen lagen, hat der Künstler auch vom roten Haus zwei weitere, kleinere Versionen geschaffen. Denn Munch soll es Zeit seines Lebens schwer gefallen sein, sich von seinen wichtigen Gemälden zu trennen, weshalb er häufig nach dem Verkauf eine weitere Version desselben Bildthemas schuf. "Das rote Haus" wählt Munch bereits im Entstehungsjahr für die von Gustav Hartaub initiierte Munch-Ausstellung der Kunsthalle Mannheim aus. Obwohl Hartlaub mehrfach ernsthafte Kaufabsichten bekundet, entscheidet sich der Künstler schließlich, das Gemälde von Mannheim weiter nach Berlin zur großen Munch-Retrospektive in der Nationalgalerie zu schicken. Wie bereits in Mannheim wird die großformatige Landschaft auch hier im Ausstellungskatalog abgebildet. Mit der von Ludwig Justi für die Nationalgalerie initiierten Ausstellung ist Munch gut zwei Jahrzehnte nach seiner legendären Berliner Skandal-Ausstellung zu Lebzeiten auf dem Höhepunkt seiner künstlerischen Anerkennung. Im direkten Anschluss an die Berliner Retrospektive vermittelt die Dresdner Galerie Arnold "Das rote Haus" in die bedeutende süddeutsche Expressionismus-Sammlung des Fabrikanten Max Glaeser. Das qualitativ herausragende und vielfach ausgestellte Gemälde wird schließlich 1964 über die Galerie Wolfgang Ketterer in die bedeutende Munch-Sammlung von Sigval Bergesen d. y. in Oslo veräußert, welche unter anderem auch eine Version des weltbekannten, erotischen Munch-Gemäldes "Madonna" (1894) umfasst, und befindet sich seither in Familienbesitz. Munch selbst sollte diese Rückkehr seines wichtigen Gemäldes "Das rote Haus" nicht mehr erleben. Er stirbt 1944 einsam auf Gut Ekely bei Oslo und vermacht seinen umfangreichen künstlerischen Nachlass dem norwegischen Staat, der sein Werk seit 1963 im Munch Museet in Oslo der begeisterten Öffentlichkeit präsentiert. [JS]
Zur Provenienz
"Die beiden Werke von Munch 'Das Rote Haus' und das 'Kniende Mädchen' [...] weisen in ein Neuland künstlerischen Schaffens, das dieser große nordische Einsame heraufbeschwören half."
Der Sammler 1930, Heft 2, S. 26.
"Die Sammlung Glaeser kann sich rühmen zwei beste Werke Munch's [sic] zu besitzen, die 'Landschaft mit rotem Haus' und das 'Knieende Mädchen", um die ihn gar manches Museum beneiden dürfte. Nur schwer trennt sich der Künstler von seinen Werken, in deren Gemeinschaft er zu leben gewohnt ist. Persönliches Kennenlernen, das dem Sammler ein großes menschliches Erleben bedeutete, ermöglichte den Erwerb. – Die Bildthemen: Eine nordische, einfach-großzügige Landschaft, eine nackte Frau. Nicht geheimnisvoll - schreckliche Geschehnisse – wie sie Munch in seinen Frühwerken darzustellen liebte – sondern einfachste Natur. Und doch, welch übermenschliche, heroische Größe, die ähnlich einer Symphonie Beethovens oder dem Anblick eines schroffen, wetterumtosten Gebirges, uns in banger Erregung erzittern läßt."
Hand und Maschine, 1929, Heft 1, S. 118, 120.
In der Sammlung Max Glaeser in Eselsfürth
Die Sammlung des Kommerzienrats Dr. Max Glaeser (1871–1931) zählt zu den bedeutendsten privaten Kunstkollektionen der Weimarer Republik. Bereits ab 1907 beginnt der erfolgreiche Emailfabrikant aus Eselsfürth bei Kaiserslautern mit dem Aufbau seiner beeindruckenden Sammlung – zunächst mit dem Schwerpunkt auf deutsche Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Um 1926 aber hält die Moderne Einzug. Mit sicherem Geschmack sucht Glaeser nun nach den besten Werken seiner Zeitgenossen.
Dabei ist ihm der persönliche Kontakt mit den Künstlern wichtig. Eine Geschäftsreise im Jahr 1927 nach Kopenhagen nutzt Glaeser daher, um Edvard Munch aufzusuchen, dessen Werke er in seiner Sammlung wissen will. Das "Rote Haus" entdeckt er jedoch nicht im Atelier in Oslo, sondern auf der Rückreise – im Schaufenster der Galerie Ernst Arnold in Dresden. Der Künstler hat das Bild hier für eine Ausstellung verliehen. Unsigniert wie viele derjenigen Gemälde, die Munch kaum je für einen "Markt" vorgesehen hatte. Ein Briefwechsel des Künstlers mit Ludwig Gutbier von der Galerie Arnold bezeugt, dass Munch
für Glaeser eine nachträgliche Signatur noch vorgenommen hätte, wozu es jedoch nicht mehr kam (Munchmuseum Oslo, Brief MM 3348).
Glaeser ist vom "Roten Haus" so fasziniert, dass er sogar bereit wäre, auf alles zu verzichten, was er zuvor persönlich bei Munch ausgewählt hat. Und seine Bemühungen tragen Früchte: "Das 'Rote Haus' ist an Herrn Glaeser abgegangen", meldet Galerist Gutbier an Munch am 27. Oktober 1927 (Munchmuseum Oslo, Brief MM 3734). Der Sammler setzt sich damit gegen einen namhaften Mitbewerber durch: die Kunsthalle Mannheim.
Die Präsentation des Werkes in der Sammlung Glaeser ist nicht weniger opulent als in einem Museum. Historische Fotografien geben noch heute Einblick in die 1927/28 im Stil des Neuen Bauens errichtete Villa. "Das rote Haus" hängt neben dem großen "Knieenden Akt" (Abb.) über dem weißen Flügel – in der direkten Sichtachse aller, die über den Vorraum in den Salon treten.
Von Eselsfürth nach Dresden
Als Max Glaeser im Mai 1931 infolge eines Herzleidens verstirbt, befindet sich "Das rote Haus" in seinem Nachlass. Die ganze Sammlung ist testamentarisch dem Museum in Kaiserslautern versprochen, mit einem Vorkaufsrecht zum günstigen Preis von 100.000 Reichsmark. Doch bereits 1931 ist der Nationalsozialismus in der Region politisch tonangebend – der Ankauf der avantgardistischen Sammlung wird verhindert.
Witwe Anna Glaeser bemüht sich daraufhin um Verkäufe, ein schwieriges Unterfangen angesichts der wirtschaftlichen Lage jener Jahre. In der Frühjahrsausstellung des Kunsthauses Zürich 1932, die Munch und Gauguin gewidmet ist, wird das Gemälde für bemerkenswerte 43.000 Franken zum Verkauf angeboten. Es verbleibt jedoch zunächst im Familienbesitz.
Im Dezember 1935 bietet schließlich Anna Glaeser der Galerie Heinemann in München mehrere Kunstwerke an, darunter auch beide Munch-Gemälde. Ein Verkauf kommt nicht zustande. Aber bald darauf wird auch der Dresdner Kunsthändler Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst Fides) auf den Nachlass Glaeser aufmerksam. Er verfügt nicht über direkten Kontakt zur Familie und wendet sich deshalb im November 1936 an die Deutsche Bank in Kaiserslautern. Diese leitet seine Anfrage an den Major a.D. Arthur Romanic weiter, den Schwiegersohn von Max Glaeser (Nachlass Probst, Archiv der Avantgarden, Dresden, A3377-V019-01).
Die Folgekorrespondenz zwischen Romanic und Probst ist nicht erhalten, aber ganz offensichtlich verlaufen die Verhandlungen erfolgreich. Denn als die Galerie Heinemann im Januar 1937 erneut wegen der Munch-Werke bei Glaesers anfragt, erhält man die Mitteilung, beide Bilder seien verkauft. Sie haben augenscheinlich, ebenso wie Lovis Corinths "Chrysanthemen und Kalla", den Weg in die Galerie Neue Kunst Fides gefunden.
Aus der Sammlung Schenck zurück nach Norwegen
Und auch einen solventen Kunden für das "Rote Haus" hat Probst wohl bereits: In der Sammlung des Holzunternehmers Friedrich Karl Schenck (1889–1963) aus Sattelmühle, einem regelmäßigen Käufer von Probst, sind bald zwei Werke aus der Glaeser-Sammlung nachweisbar. Munchs "Rotes Haus" ist mit dem höchsten Preis auf einer Sammlungsschätzung aus dem Jahr 1942 verzeichnet, neben Werken etwa von Franz Marc, Gustave Courbet oder Auguste Renoir (Nachlass Probst, Archiv der Avantgarden, Dresden, Nr. A5139-V024-01).
Schencks umfangreiche und kapitale Kollektion, die noch bis weit in die 1950er Jahre hinein erweitert wird, gelangt 1963/64 über die Galerie Wolfgang Ketterer in den Verkauf. Auch das "Rote Haus" wird angeboten – zum spektakulären Preis von 450.000 D-Mark. Das Werk sorgt für einiges Aufsehen, das "Handelsblatt" berichtet, die Anfragen aus aller Welt landen in Stuttgart.
Auch Johann H. Langaard, Direktor des Munch-Museums in Oslo, wird aufmerksam: "Ich habe es immer als ein sehr schönes Beispiel der späteren Landschaftskunst Munchs betrachtet und möchte gern sehen, dass es nach Norwegen zurückkehrt", schreibt er am 10. Februar 1964 an Wolfgang Ketterer. Und Langaards Plan geht auf: Nur wenige Wochen später vermittelt er den Ankauf durch den norwegischen Reeder Sigval Bergesen d. J. (1893–1980), einen ausgewiesenen Munch-Kenner und -Sammler. Das Werk verbleibt über 60 Jahre in der Familie Bergesen und kann nun erneut angeboten werden - mit einer bemerkenswerten Geschichte vom Atelier des Künstlers bis hin zum heutigen Tag. [AT]
Edvard Munch zählt neben Vincent van Gogh und Henri Matisse zu den Pionieren der europäischen Moderne. Ohne sie und ihren mutigen Erneuerungsdrang wäre der Expressionismus, allem voran die Malerei der "Brücke" und des "Blauen Reiter" nicht möglich gewesen. Sie sind die treibenden Kräfte, die bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der die späteren europäischen Kunstmetropolen Berlin und Paris noch von der klassischen Salon- und Historienmalerei dominiert sind, radikal Neues erproben. Die Malerei des jungen Norwegers Edvard Munch schlägt 1892 in Berlin ein wie ein Meteorid. Bereits nach wenigen Tagen wird seine auf Einladung des Vereins Berliner Künstler veranstaltete Ausstellung auf Betreiben Anton von Werners, des Direktors der Königlichen Hochschule der Bildenden Künste, begleitet von Protesten und Handgreiflichkeiten unter den Vereinsmitgliedern geschlossen. Aber der Skandal um Munchs vollkommen neuartige, als roh und unfertig empfundene Malerei hatte den konservativen Berliner Kunstbetrieb ein für alle mal wachgerüttelt. Munch löste in Berlin eine Art Urknall aus, der die wenige Jahre später vollzogene Gründung der Berliner Secession unter der Leitung Max Liebermanns und das schon kurz darauf einsetzende Aufkommen des Expressionismus erst möglich gemacht hat. Munchs Unangepasstheit, seine unfassbar emotionsgeladene und akademische Traditionen hinter sich lassende Malerei sollte fortan zu einer der wichtigsten Kräfte für die europäische Avantgarde werden.
Leben, Liebe, Angst und Tod – Munch als Meister der nordischen Seelenlandschaft
Es ist das emotional aufgeladene Naturempfinden des Menschen, das Munch selbst, nach impressionistischen Anfängen, als sein persönliches künstlerisches Erweckungserlebnis beschreibt und das für seine insgesamt vier, heute als ikonisch geltenden Gemäldeversionen von "Der Schrei" verantwortlich ist: "Ich ging die Straße hinunter mit zwei Freunden – als die Sonne unterging – der Himmel sich plötzlich blutrot färbte […] über dem blauschwarzen Fjord und der Stadt lagen Blut und Feuerzungen – [...] und ich, stand da zitternd vor Angst – und ich fühlte, daß ein unendlicher Schrei durch die Natur ging." Munch ist es durch die verzerrte, aber symbiotische Verbindung von Natur und Mensch erstmals gelungen, das existenzielle Gefühl der Angst auf die Leinwand zu bannen. Munch, dessen Kindheit bereits aufgrund des frühen Todes seiner Mutter und seiner geliebten Schwester Sophie durch qualvolle Erfahrungen geprägt war, ist fortan der Maler existenzieller Gefühlswelten zwischen Leben, Liebe, Angst und Tod. Dies sind die abstrakten aber menschheitsbeherrschenden Themenwelten, die Munch, der zudem mehrere unglückliche Liebesbeziehungen künstlerisch zu verarbeiten hatte, auch in den Gemälden seines berühmten "Lebensfrieses" zusammenfasst und lebenslang weiterentwickelt. Zu den berühmtesten Gemälden dieser Werkgruppe zählt "Der Tanz des Lebens" (1899/1900, Norwegische Nationalgalerie, Oslo), von welchem Munch ein Jahr vor unserem Gemälde eine zweite Version malt (1925, Munch Museet, Oslo). In einer norwegischen Fjordlandschaft zeigt Munch hier tanzende, das Leben, die Liebe und den Tod symbolisierende Figuren vor einer schwermütig hinter dem Meer versinkenden Sonne. Aber Munch, der Zeit seines Lebens psychisch und physisch stark angeschlagen ist und dennoch wie ein Wunder 1918 die verheerende Spanische Grippe überlebt, malt auch immer wieder menschenleere Stimmungslandschaften, die uns aufgrund der melancholisch-nervösen Veranlagung des hoch empfindsamen Malers stets als intime und bis heute fesselnde Seelenlandschaften des Künstlers gegenübertreten.
Weit, bewegt, zerfurcht und kraftvoll – "Das rote Haus" als Sinnbild des Lebens
Während des Ersten Weltkrieges erwirbt Munch, nach zahlreichen Auslandsreisen und seiner labilen Psyche geschuldeten Klinikaufenhalten, 1916 Gut Ekely nahe Oslo, das fortan zu seinem Rückzugsort und schöpferischem Mittelpunkt wird. Neben dem Haupt- und Atelierhaus, das der Künstler alleine bewohnt, befindet sich auf dem weitläufigen Gelände mit Blick Richtung Oslo sowie über Wiesen und Obstbäume auf die Weiten des Fjords auch das rote Haus, das Munch in unserem stimmungsvollen Gemälde in leuchtenden Farben und mit bewegtem Strich auf die großformatige Leinwand setzt. In "Das rote Haus" wird die vertraute Landschaft des einsamen Künstlers, einem gemalten Tagebucheintrag gleich, zur bewegten Seelenlandschaft gesteigert. "In meiner Kunst habe ich versucht, mir das Leben und seinen Sinn zu erklären." lautet ein berühmtes, seine künstlerische Motivation erläuterndes Zitat des norwegischen Malers. Geradezu magisch ist in "Das rote Haus" die eingefangene Stimmung, des Gefühls von unendlicher Weite und gläsernem Licht, wie es für die nordische Landschaft charakteristisch ist. Noch kahl ist das fein verzweigte Geäst des knorrigen Baumes zur Rechten, dem links ein kleiner junger, gerade heranwachsender Baum gegenübersteht. Stürmisch und weit ist der bewegte Himmel, regungslos das spiegelnde Wasser, bereit durch ein über Jahrzehnte geformtes Flussbett kraftvoll ins Meer zu stürzen und sich aufzulösen in der berauschenden Unendlichkeit. Es ist die für Munchs epochales Schaffen so zentrale und bedeutende Reflexion über die eigene Endlichkeit, die hier mitschwingt, das Bewusstsein für die Verwundbarkeit und Flüchtigkeit der eigenen Existenz in Anbetracht des ewigen Schauspiels der Natur. Ein Gedanke, wie er etwa auch bereits der romantischen Malerei Caspar David Friedrichs inhärent ist, wenn er seinen "Mönch am Meer" (1808/10) oder seinen "Wanderer über dem Nebelmeer" (1818) mit einem überwältigenden Naturschauspiel konfrontiert. Anders als Friedrich aber nutzt Munch die Darstellung der Natur nicht nur als Bildlichkeit des ewig Erhabenen, sondern vielmehr als ein Spiegelbild seiner eigenen Seelenverfassung, als geradezu rauschhaft niedergeschriebenen Versuch, dem eigenen, inneren Empfinden künstlerisch Ausdruck zu verleihen. Und so ist "Das rote Haus" mit seiner wild bewegten und zerfurchten Landschaft und dem gewaltigen, noch kahlen, aber bald wieder aufs Neue kraftvoll austreibenden Baum das Abbild einer reifen Künstlerpersönlichkeit, vom Leben gezeichnet, aber gerade deshalb empfindsam, kraftvoll und lebenshungrig. Munch selbst hat rückblickend einmal recht passend formuliert: "Ich möchte das Leiden nicht missen, wie viel verdanke ich doch in meiner Kunst dem Leiden?" und "Mein Durchbruch kam ja eigentlich sehr spät […]. Aber in dieser Zeit […] fühlte ich, dass ich Kraft genug besaß um etwas Neues zu schaffen [...]“ (Edvard Munch 1939, zit. nach: Ranga Stang, Edvard Munch, Königstein i. T. 1979, S. 258.)
"Das rote Haus" – Von Munch, Kuratoren und Sammlern hoch geschätzt
Wie von allen anderen Motivkomplexen, die Munch persönlich besonders am Herzen lagen, hat der Künstler auch vom roten Haus zwei weitere, kleinere Versionen geschaffen. Denn Munch soll es Zeit seines Lebens schwer gefallen sein, sich von seinen wichtigen Gemälden zu trennen, weshalb er häufig nach dem Verkauf eine weitere Version desselben Bildthemas schuf. "Das rote Haus" wählt Munch bereits im Entstehungsjahr für die von Gustav Hartaub initiierte Munch-Ausstellung der Kunsthalle Mannheim aus. Obwohl Hartlaub mehrfach ernsthafte Kaufabsichten bekundet, entscheidet sich der Künstler schließlich, das Gemälde von Mannheim weiter nach Berlin zur großen Munch-Retrospektive in der Nationalgalerie zu schicken. Wie bereits in Mannheim wird die großformatige Landschaft auch hier im Ausstellungskatalog abgebildet. Mit der von Ludwig Justi für die Nationalgalerie initiierten Ausstellung ist Munch gut zwei Jahrzehnte nach seiner legendären Berliner Skandal-Ausstellung zu Lebzeiten auf dem Höhepunkt seiner künstlerischen Anerkennung. Im direkten Anschluss an die Berliner Retrospektive vermittelt die Dresdner Galerie Arnold "Das rote Haus" in die bedeutende süddeutsche Expressionismus-Sammlung des Fabrikanten Max Glaeser. Das qualitativ herausragende und vielfach ausgestellte Gemälde wird schließlich 1964 über die Galerie Wolfgang Ketterer in die bedeutende Munch-Sammlung von Sigval Bergesen d. y. in Oslo veräußert, welche unter anderem auch eine Version des weltbekannten, erotischen Munch-Gemäldes "Madonna" (1894) umfasst, und befindet sich seither in Familienbesitz. Munch selbst sollte diese Rückkehr seines wichtigen Gemäldes "Das rote Haus" nicht mehr erleben. Er stirbt 1944 einsam auf Gut Ekely bei Oslo und vermacht seinen umfangreichen künstlerischen Nachlass dem norwegischen Staat, der sein Werk seit 1963 im Munch Museet in Oslo der begeisterten Öffentlichkeit präsentiert. [JS]
Zur Provenienz
"Die beiden Werke von Munch 'Das Rote Haus' und das 'Kniende Mädchen' [...] weisen in ein Neuland künstlerischen Schaffens, das dieser große nordische Einsame heraufbeschwören half."
Der Sammler 1930, Heft 2, S. 26.
"Die Sammlung Glaeser kann sich rühmen zwei beste Werke Munch's [sic] zu besitzen, die 'Landschaft mit rotem Haus' und das 'Knieende Mädchen", um die ihn gar manches Museum beneiden dürfte. Nur schwer trennt sich der Künstler von seinen Werken, in deren Gemeinschaft er zu leben gewohnt ist. Persönliches Kennenlernen, das dem Sammler ein großes menschliches Erleben bedeutete, ermöglichte den Erwerb. – Die Bildthemen: Eine nordische, einfach-großzügige Landschaft, eine nackte Frau. Nicht geheimnisvoll - schreckliche Geschehnisse – wie sie Munch in seinen Frühwerken darzustellen liebte – sondern einfachste Natur. Und doch, welch übermenschliche, heroische Größe, die ähnlich einer Symphonie Beethovens oder dem Anblick eines schroffen, wetterumtosten Gebirges, uns in banger Erregung erzittern läßt."
Hand und Maschine, 1929, Heft 1, S. 118, 120.
In der Sammlung Max Glaeser in Eselsfürth
Die Sammlung des Kommerzienrats Dr. Max Glaeser (1871–1931) zählt zu den bedeutendsten privaten Kunstkollektionen der Weimarer Republik. Bereits ab 1907 beginnt der erfolgreiche Emailfabrikant aus Eselsfürth bei Kaiserslautern mit dem Aufbau seiner beeindruckenden Sammlung – zunächst mit dem Schwerpunkt auf deutsche Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Um 1926 aber hält die Moderne Einzug. Mit sicherem Geschmack sucht Glaeser nun nach den besten Werken seiner Zeitgenossen.
Dabei ist ihm der persönliche Kontakt mit den Künstlern wichtig. Eine Geschäftsreise im Jahr 1927 nach Kopenhagen nutzt Glaeser daher, um Edvard Munch aufzusuchen, dessen Werke er in seiner Sammlung wissen will. Das "Rote Haus" entdeckt er jedoch nicht im Atelier in Oslo, sondern auf der Rückreise – im Schaufenster der Galerie Ernst Arnold in Dresden. Der Künstler hat das Bild hier für eine Ausstellung verliehen. Unsigniert wie viele derjenigen Gemälde, die Munch kaum je für einen "Markt" vorgesehen hatte. Ein Briefwechsel des Künstlers mit Ludwig Gutbier von der Galerie Arnold bezeugt, dass Munch
für Glaeser eine nachträgliche Signatur noch vorgenommen hätte, wozu es jedoch nicht mehr kam (Munchmuseum Oslo, Brief MM 3348).
Glaeser ist vom "Roten Haus" so fasziniert, dass er sogar bereit wäre, auf alles zu verzichten, was er zuvor persönlich bei Munch ausgewählt hat. Und seine Bemühungen tragen Früchte: "Das 'Rote Haus' ist an Herrn Glaeser abgegangen", meldet Galerist Gutbier an Munch am 27. Oktober 1927 (Munchmuseum Oslo, Brief MM 3734). Der Sammler setzt sich damit gegen einen namhaften Mitbewerber durch: die Kunsthalle Mannheim.
Die Präsentation des Werkes in der Sammlung Glaeser ist nicht weniger opulent als in einem Museum. Historische Fotografien geben noch heute Einblick in die 1927/28 im Stil des Neuen Bauens errichtete Villa. "Das rote Haus" hängt neben dem großen "Knieenden Akt" (Abb.) über dem weißen Flügel – in der direkten Sichtachse aller, die über den Vorraum in den Salon treten.
Von Eselsfürth nach Dresden
Als Max Glaeser im Mai 1931 infolge eines Herzleidens verstirbt, befindet sich "Das rote Haus" in seinem Nachlass. Die ganze Sammlung ist testamentarisch dem Museum in Kaiserslautern versprochen, mit einem Vorkaufsrecht zum günstigen Preis von 100.000 Reichsmark. Doch bereits 1931 ist der Nationalsozialismus in der Region politisch tonangebend – der Ankauf der avantgardistischen Sammlung wird verhindert.
Witwe Anna Glaeser bemüht sich daraufhin um Verkäufe, ein schwieriges Unterfangen angesichts der wirtschaftlichen Lage jener Jahre. In der Frühjahrsausstellung des Kunsthauses Zürich 1932, die Munch und Gauguin gewidmet ist, wird das Gemälde für bemerkenswerte 43.000 Franken zum Verkauf angeboten. Es verbleibt jedoch zunächst im Familienbesitz.
Im Dezember 1935 bietet schließlich Anna Glaeser der Galerie Heinemann in München mehrere Kunstwerke an, darunter auch beide Munch-Gemälde. Ein Verkauf kommt nicht zustande. Aber bald darauf wird auch der Dresdner Kunsthändler Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst Fides) auf den Nachlass Glaeser aufmerksam. Er verfügt nicht über direkten Kontakt zur Familie und wendet sich deshalb im November 1936 an die Deutsche Bank in Kaiserslautern. Diese leitet seine Anfrage an den Major a.D. Arthur Romanic weiter, den Schwiegersohn von Max Glaeser (Nachlass Probst, Archiv der Avantgarden, Dresden, A3377-V019-01).
Die Folgekorrespondenz zwischen Romanic und Probst ist nicht erhalten, aber ganz offensichtlich verlaufen die Verhandlungen erfolgreich. Denn als die Galerie Heinemann im Januar 1937 erneut wegen der Munch-Werke bei Glaesers anfragt, erhält man die Mitteilung, beide Bilder seien verkauft. Sie haben augenscheinlich, ebenso wie Lovis Corinths "Chrysanthemen und Kalla", den Weg in die Galerie Neue Kunst Fides gefunden.
Aus der Sammlung Schenck zurück nach Norwegen
Und auch einen solventen Kunden für das "Rote Haus" hat Probst wohl bereits: In der Sammlung des Holzunternehmers Friedrich Karl Schenck (1889–1963) aus Sattelmühle, einem regelmäßigen Käufer von Probst, sind bald zwei Werke aus der Glaeser-Sammlung nachweisbar. Munchs "Rotes Haus" ist mit dem höchsten Preis auf einer Sammlungsschätzung aus dem Jahr 1942 verzeichnet, neben Werken etwa von Franz Marc, Gustave Courbet oder Auguste Renoir (Nachlass Probst, Archiv der Avantgarden, Dresden, Nr. A5139-V024-01).
Schencks umfangreiche und kapitale Kollektion, die noch bis weit in die 1950er Jahre hinein erweitert wird, gelangt 1963/64 über die Galerie Wolfgang Ketterer in den Verkauf. Auch das "Rote Haus" wird angeboten – zum spektakulären Preis von 450.000 D-Mark. Das Werk sorgt für einiges Aufsehen, das "Handelsblatt" berichtet, die Anfragen aus aller Welt landen in Stuttgart.
Auch Johann H. Langaard, Direktor des Munch-Museums in Oslo, wird aufmerksam: "Ich habe es immer als ein sehr schönes Beispiel der späteren Landschaftskunst Munchs betrachtet und möchte gern sehen, dass es nach Norwegen zurückkehrt", schreibt er am 10. Februar 1964 an Wolfgang Ketterer. Und Langaards Plan geht auf: Nur wenige Wochen später vermittelt er den Ankauf durch den norwegischen Reeder Sigval Bergesen d. J. (1893–1980), einen ausgewiesenen Munch-Kenner und -Sammler. Das Werk verbleibt über 60 Jahre in der Familie Bergesen und kann nun erneut angeboten werden - mit einer bemerkenswerten Geschichte vom Atelier des Künstlers bis hin zum heutigen Tag. [AT]
125000601
Edvard Munch
Das rote Haus (Det røde hus), 1926.
Öl auf Leinwand
Schätzpreis: € 1.200.000 - 1.800.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Christoph Calaminus
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.