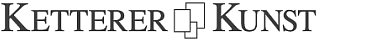Auktion: 600 / Evening Sale am 05.12.2025 in München  Lot 125001222
Lot 125001222
 Lot 125001222
Lot 125001222
Video
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
125001222
Thomas Schütte
Bronzefrau Nr. 12, 2003.
Bronze patiniert, auf einem Stahl-Tisch
Schätzpreis: € 1.000.000 - 1.500.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Thomas Schütte
1954
Bronzefrau Nr. 12. 2003.
Bronze patiniert, auf einem Stahl-Tisch.
Am linken Fuß mit der Signatur, der Datierung und dem Gießerstempel "Kayser & Klippel Düsseldorf". Unikat. 130 x 125 x 251 cm (51,1 x 49,2 x 98,8 in).
• Unikat.
• Monumental, verletzlich, existenziell: Thomas Schütte reflektiert die Daseinsformen der Weiblichkeit.
• Seine "Bronzefrauen"-Serie ist ein zentraler Beitrag zur figurativen Skulptur der Gegenwart.
• Bis November 2025 widmet die Pinault Collection in der Punta della Dogana, Venedig, Thomas Schütte eine umfassende Werkschau.
• Die "Bronzefrauen" gehören zu den gesuchtesten Arbeiten des Künstlers auf dem internationalen Auktionsmarkt.
• Zuletzt zeigte u. a. das Museum of Modern Art, New York, eine umfassende Retrospektive (2024/2025).
PROVENIENZ: Privatsammlung London.
LITERATUR: https://thomas-schuette.de/main.php?kat=2.08.10.089 (gelesen 1.10.2025 um 17:48).
"Thomas Schütte ist zweifellos einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler, aber auch einer der eigenwilligsten. Er ist nie irgendwelchen Trends gefolgt."
Camille Morineau, Kuratorin der Thomas-Schütte-Ausstellung 2025 in der Punta della Dogana, Venedig, Pinault Collection.
"Man kann ja Kunst gar nicht machen. Die passiert, manchmal."
Thomas Schütte
1954
Bronzefrau Nr. 12. 2003.
Bronze patiniert, auf einem Stahl-Tisch.
Am linken Fuß mit der Signatur, der Datierung und dem Gießerstempel "Kayser & Klippel Düsseldorf". Unikat. 130 x 125 x 251 cm (51,1 x 49,2 x 98,8 in).
• Unikat.
• Monumental, verletzlich, existenziell: Thomas Schütte reflektiert die Daseinsformen der Weiblichkeit.
• Seine "Bronzefrauen"-Serie ist ein zentraler Beitrag zur figurativen Skulptur der Gegenwart.
• Bis November 2025 widmet die Pinault Collection in der Punta della Dogana, Venedig, Thomas Schütte eine umfassende Werkschau.
• Die "Bronzefrauen" gehören zu den gesuchtesten Arbeiten des Künstlers auf dem internationalen Auktionsmarkt.
• Zuletzt zeigte u. a. das Museum of Modern Art, New York, eine umfassende Retrospektive (2024/2025).
PROVENIENZ: Privatsammlung London.
LITERATUR: https://thomas-schuette.de/main.php?kat=2.08.10.089 (gelesen 1.10.2025 um 17:48).
"Thomas Schütte ist zweifellos einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler, aber auch einer der eigenwilligsten. Er ist nie irgendwelchen Trends gefolgt."
Camille Morineau, Kuratorin der Thomas-Schütte-Ausstellung 2025 in der Punta della Dogana, Venedig, Pinault Collection.
"Man kann ja Kunst gar nicht machen. Die passiert, manchmal."
Thomas Schütte
Mit der Serie "Frauen" (1998–2006) hat Thomas Schütte einen der zentralen Beiträge zur figurativen Bildhauerei der Gegenwart geschaffen. Seit den späten 1990er Jahren arbeitet Schütte an dieser Serie, die ein wesentliches Kapitel seines plastischen Denkens geworden ist. Sie umfasst 18 Großskulpturen. Seine "Frauen" sind weder Muse noch Modell. Der weibliche Körper – über Jahrhunderte Projektionsfläche für Ideale, Mythen und Macht – wird bei Schütte zu einem Terrain der Befragung.
Material als Ausdrucksform
Am Anfang jeder dieser großformatigen Skulpturen standen kleine Keramiken, bei denen die weiblichen Figuren aus einem Stück Ton geformt sind, also nicht additiv aus mehreren Stücken zusammengesetzt, sondern modellierend komplett aus einem Stück geformt, und aus der Basisplatte herauswachsen. Er selbst bezeichnet sie als "ceramic effusions", als Ausflüsse oder "Ergüsse", die ohne Vorzeichnung oder Modell entstanden sind. Im nächsten Schritt werden diese kleinen Figuren in der Gießerei zu monumentalen Styroporfiguren vergrößert. Ihnen folgen die gegossenen Skulpturen.
Von jeder Figur gibt es jeweils Fassungen im Material Bronze, Cortenstahl und Aluminium. Jede Figur für sich ist aufgrund der besonderen Oberflächenbearbeitung ein Unikat. Es existiert eine weitere Ausführung der "Bronzefrau Nr. 12" mit einer schwarz-grünen Patina. Die einzelnen Figuren in ihrem dem Material und der Form geschuldeten Erscheinungsbild werden zum Gegenpol der vereinheitlichten Oberfläche unserer Bildkultur: Manche der "Frauen" sind roh, wirken aufgewühlt, manche scheinen kraftvoll und mächtig, manche versunken und in sich ruhend. Die jeweilige Oberfläche beeinflusst die Wirkung maßgeblich.
Die konsequente Differenzierung und Umsetzung in diesen drei verschiedenen Materialien zeigt exemplarisch die herausragende Relevanz des jeweiligen Werkstoffes für Thomas Schütte: kühles glattes Aluminium, wehrhaft schwerer Cortenstahl und edle weiche Bronze. Schüttes Arbeitsweise gleicht hierin einem fortgesetzten Dialog mit der Geschichte der Skulptur. Er kennt ihre Konventionen, ihre Hierarchien, ihre Bildtypen – und unterwandert sie, indem er ihre Sprache verlangsamt und verdichtet. Wo klassische Figuren Harmonie suchten, sucht Schütte die Brüche. Wo andere Glätte anstrebten, lässt er Spuren und Wunden sichtbar. Seine "Frauen" sind keine Abbilder, sondern Zustände – Momente zwischen Entstehen und Vergehen. Sie verkörpern eine Form von Existenz, die nicht auf Dauer zielt, sondern auf Gegenwärtigkeit.
"Bronzefrau Nr. 12" – Körperlichkeit jenseits klassischer Ideale
Elegant, erhaben und nahbar liegt die Figur auf dem zum Sockel gewordenen rohen Stahltisch. In einer Ansicht mag sie verletzlich wirken, in anderer Perspektive friedlich in sich ruhend. "Bronzefrau Nr. 12" verdeutlicht, wie der Künstler an die lange Geschichte des weiblichen Aktes anknüpft und sie zugleich kritisch bricht: Der Körper liegt auf einem Tisch, nicht auf einem Sockel. Dieser Tisch ist Werkbank und Ruhebett zugleich.
Das ursprünglich aus Ton spontan Entstandene verwandelt sich so in eine schwergewichtige, dauerhafte Skulptur, die sich bewusst auf die Tradition klassischer Bildhauerei bezieht. Wie der Künstler selbst betont, denkt er bei der Arbeit weniger an die Last der Geschichte als vielmehr an die Zukunft: Entscheidend sei, dass die Werke physisch präsent sind und zu grundlegenden Fragen anregen.
"Bronzefrau Nr. 12" zeigt eine auf einem hohen Stahlpodest präsentierte Figur, deren Körperlichkeit zugleich vertraut und befremdlich wirkt; ausmodellierte, kräftige Formen korrespondieren mit einer zärtlichen, liebevollen Haltung, sie ruht und ist dennoch kraftvoll und agil. Mit den stark ausgeprägten Formen unterläuft Schütte die jahrhundertealte Tradition des idealisierten weiblichen Körpers, die von Aristide Maillol bis Henry Moore als Experimentierfeld für Abstraktion und Figuration diente. Statt harmonischer Vollkommenheit modelliert Thomas Schütte einen Körper, der Widersprüche zeigt.
"Bronzefrau Nr. 12" stellt kein Abbild dar, sondern thematisiert Skulptur selbst: ihre Materialität, ihre Geschichte, ihre Deutungsoffenheit.
Diese Deutungsvielfalt ist in allen Frauenfiguren der Serie zu finden: Der Gedankenraum zwischen Idol und Opfer, zwischen Monumentalität und Fragilität ist wesentlich für die Rezeption der Werke. Sie zeigen Körper, die zugleich kraftvoll und beschädigt sind, heroisch und gebrochen. Schütte selbst spricht von Figuren, die Ausrufezeichen oder Fragezeichen gleichen: Sie markieren Positionen, ohne sie abschließend zu erklären. In dieser Offenheit liegt die eigentliche Kraft der Serie.
Auch die Wahl des Sockels entspricht diesem Verständnis. Schütte ersetzt den traditionellen, geschlossenen Block durch einen stählernen Tisch mit kantigen, funktionalen Beinen. Dieser wirkt wie Werkbank oder Tribunal: Er verweist auf den Herstellungsprozess, betont aber auch die Präsentationssituation als Teil des Werkes. Die "Frauen" werden hiermit exponiert und zugleich isoliert. Damit verbindet sich eine ambivalente Wirkung: Sie erscheinen monumental und mächtig, zugleich aber verletzlich, ausgeliefert und einsam.
"Frauen" und die Tradition des weiblichen Aktes
In der Sequenz der "Frauen" wendet sich Thomas Schütte einem der ältesten Themen der Kunst zu, der Darstellung der unbekleideten Frau. Darstellungen des nackten weiblichen Körpers begleiten die Kunst seit ihren Anfängen. Von der Venus von Willendorf, Sinnbild für Fruchtbarkeit und Überfluss, über die idealisierten Aphroditen des antiken Griechenland bis zu den Renaissance-Meistern Botticelli und Giorgione, die das Ideal göttlicher Liebe in der Aktfigur wiederbelebten – stets spiegelte der weibliche Körper die Werte seiner Zeit.
Mit Tizian wandelte sich dieses Ideal: Seine "Venus von Urbino" (1538) erhob den weiblichen Akt zum Ausdruck sinnlicher Selbstbestimmung. Später verlängerte Ingres in der "Großen Odaliske" (1814) den Körper seiner Figur, um ihre erotische Anziehungskraft zu steigern, während Manets "Olympia" (1865) die gesellschaftliche Heuchelei ihrer Epoche bloßlegte.
Im 20. Jahrhundert wurde der weibliche Körper zum Experimentierfeld der Moderne: Picasso und die Kubisten nutzten ihn als Ausgangspunkt für abstrakte Formstudien, Henry Moore verwandelte ihn in eine Landschaft weicher Hügel.
Thomas Schüttes Serie der "Frauen" knüpft an diese lange Geschichte des weiblichen Aktes an und befragt zugleich dessen heutige Bedeutung.
Darüber hinaus muss die Werkreihe auch vor dem Hintergrund deutscher Nachkriegskunst gelesen werden. Nach dem Missbrauch figürlicher Darstellungen durch faschistische Regime stellte sich die Frage, ob eine Fortführung der Figuration überhaupt möglich sei. Schütte gelingt es, diese Tradition nicht zu verleugnen, sondern in eine neue, kritische Form zu überführen. Seine Skulpturen sind weder rein konservativ noch bloß destruktiv, sondern eröffnen ein Terrain, auf dem die Möglichkeiten figurativer Kunst neu verhandelt werden können.
"Bronzefrau Nr. 12" ist somit nicht nur eine Darstellung des weiblichen Körpers, sondern ein Reflexionsraum über Skulptur an sich: über Material, Maßstab, Präsentation und historische Bezüge. Schüttes Kunst erhebt keinen Anspruch auf endgültige Antworten – sie formuliert Fragen, die offen bleiben, und eröffnet so einen Raum, in dem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Skulptur neu verbinden. [EH]
"Frauen" in Ausstellungen
Mit der Serie der "Frauen", einem Schlüsselwerk innerhalb seines Œuvres, hat Thomas Schütte in den vergangenen Jahren weltweit in bedeutenden Einzelausstellungen Maßstäbe gesetzt.
2025: Gagosian Gallery, New York.
2024/25: The Museum of Modern Art, New York.
2019 Kunsthaus Bregenz.
2016: Moderna Museet, Stockholm.
2013: Fondation Beyeler, Riehen/Basel.
2014: Museum Folkwang, Essen.
2013/14: me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht.
2013: Sara Hildén Art Museum, Tampere.
2012: Castello di Rivoli, Turin.
2010: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
2009: Haus der Kunst, München.
Material als Ausdrucksform
Am Anfang jeder dieser großformatigen Skulpturen standen kleine Keramiken, bei denen die weiblichen Figuren aus einem Stück Ton geformt sind, also nicht additiv aus mehreren Stücken zusammengesetzt, sondern modellierend komplett aus einem Stück geformt, und aus der Basisplatte herauswachsen. Er selbst bezeichnet sie als "ceramic effusions", als Ausflüsse oder "Ergüsse", die ohne Vorzeichnung oder Modell entstanden sind. Im nächsten Schritt werden diese kleinen Figuren in der Gießerei zu monumentalen Styroporfiguren vergrößert. Ihnen folgen die gegossenen Skulpturen.
Von jeder Figur gibt es jeweils Fassungen im Material Bronze, Cortenstahl und Aluminium. Jede Figur für sich ist aufgrund der besonderen Oberflächenbearbeitung ein Unikat. Es existiert eine weitere Ausführung der "Bronzefrau Nr. 12" mit einer schwarz-grünen Patina. Die einzelnen Figuren in ihrem dem Material und der Form geschuldeten Erscheinungsbild werden zum Gegenpol der vereinheitlichten Oberfläche unserer Bildkultur: Manche der "Frauen" sind roh, wirken aufgewühlt, manche scheinen kraftvoll und mächtig, manche versunken und in sich ruhend. Die jeweilige Oberfläche beeinflusst die Wirkung maßgeblich.
Die konsequente Differenzierung und Umsetzung in diesen drei verschiedenen Materialien zeigt exemplarisch die herausragende Relevanz des jeweiligen Werkstoffes für Thomas Schütte: kühles glattes Aluminium, wehrhaft schwerer Cortenstahl und edle weiche Bronze. Schüttes Arbeitsweise gleicht hierin einem fortgesetzten Dialog mit der Geschichte der Skulptur. Er kennt ihre Konventionen, ihre Hierarchien, ihre Bildtypen – und unterwandert sie, indem er ihre Sprache verlangsamt und verdichtet. Wo klassische Figuren Harmonie suchten, sucht Schütte die Brüche. Wo andere Glätte anstrebten, lässt er Spuren und Wunden sichtbar. Seine "Frauen" sind keine Abbilder, sondern Zustände – Momente zwischen Entstehen und Vergehen. Sie verkörpern eine Form von Existenz, die nicht auf Dauer zielt, sondern auf Gegenwärtigkeit.
"Bronzefrau Nr. 12" – Körperlichkeit jenseits klassischer Ideale
Elegant, erhaben und nahbar liegt die Figur auf dem zum Sockel gewordenen rohen Stahltisch. In einer Ansicht mag sie verletzlich wirken, in anderer Perspektive friedlich in sich ruhend. "Bronzefrau Nr. 12" verdeutlicht, wie der Künstler an die lange Geschichte des weiblichen Aktes anknüpft und sie zugleich kritisch bricht: Der Körper liegt auf einem Tisch, nicht auf einem Sockel. Dieser Tisch ist Werkbank und Ruhebett zugleich.
Das ursprünglich aus Ton spontan Entstandene verwandelt sich so in eine schwergewichtige, dauerhafte Skulptur, die sich bewusst auf die Tradition klassischer Bildhauerei bezieht. Wie der Künstler selbst betont, denkt er bei der Arbeit weniger an die Last der Geschichte als vielmehr an die Zukunft: Entscheidend sei, dass die Werke physisch präsent sind und zu grundlegenden Fragen anregen.
"Bronzefrau Nr. 12" zeigt eine auf einem hohen Stahlpodest präsentierte Figur, deren Körperlichkeit zugleich vertraut und befremdlich wirkt; ausmodellierte, kräftige Formen korrespondieren mit einer zärtlichen, liebevollen Haltung, sie ruht und ist dennoch kraftvoll und agil. Mit den stark ausgeprägten Formen unterläuft Schütte die jahrhundertealte Tradition des idealisierten weiblichen Körpers, die von Aristide Maillol bis Henry Moore als Experimentierfeld für Abstraktion und Figuration diente. Statt harmonischer Vollkommenheit modelliert Thomas Schütte einen Körper, der Widersprüche zeigt.
"Bronzefrau Nr. 12" stellt kein Abbild dar, sondern thematisiert Skulptur selbst: ihre Materialität, ihre Geschichte, ihre Deutungsoffenheit.
Diese Deutungsvielfalt ist in allen Frauenfiguren der Serie zu finden: Der Gedankenraum zwischen Idol und Opfer, zwischen Monumentalität und Fragilität ist wesentlich für die Rezeption der Werke. Sie zeigen Körper, die zugleich kraftvoll und beschädigt sind, heroisch und gebrochen. Schütte selbst spricht von Figuren, die Ausrufezeichen oder Fragezeichen gleichen: Sie markieren Positionen, ohne sie abschließend zu erklären. In dieser Offenheit liegt die eigentliche Kraft der Serie.
Auch die Wahl des Sockels entspricht diesem Verständnis. Schütte ersetzt den traditionellen, geschlossenen Block durch einen stählernen Tisch mit kantigen, funktionalen Beinen. Dieser wirkt wie Werkbank oder Tribunal: Er verweist auf den Herstellungsprozess, betont aber auch die Präsentationssituation als Teil des Werkes. Die "Frauen" werden hiermit exponiert und zugleich isoliert. Damit verbindet sich eine ambivalente Wirkung: Sie erscheinen monumental und mächtig, zugleich aber verletzlich, ausgeliefert und einsam.
"Frauen" und die Tradition des weiblichen Aktes
In der Sequenz der "Frauen" wendet sich Thomas Schütte einem der ältesten Themen der Kunst zu, der Darstellung der unbekleideten Frau. Darstellungen des nackten weiblichen Körpers begleiten die Kunst seit ihren Anfängen. Von der Venus von Willendorf, Sinnbild für Fruchtbarkeit und Überfluss, über die idealisierten Aphroditen des antiken Griechenland bis zu den Renaissance-Meistern Botticelli und Giorgione, die das Ideal göttlicher Liebe in der Aktfigur wiederbelebten – stets spiegelte der weibliche Körper die Werte seiner Zeit.
Mit Tizian wandelte sich dieses Ideal: Seine "Venus von Urbino" (1538) erhob den weiblichen Akt zum Ausdruck sinnlicher Selbstbestimmung. Später verlängerte Ingres in der "Großen Odaliske" (1814) den Körper seiner Figur, um ihre erotische Anziehungskraft zu steigern, während Manets "Olympia" (1865) die gesellschaftliche Heuchelei ihrer Epoche bloßlegte.
Im 20. Jahrhundert wurde der weibliche Körper zum Experimentierfeld der Moderne: Picasso und die Kubisten nutzten ihn als Ausgangspunkt für abstrakte Formstudien, Henry Moore verwandelte ihn in eine Landschaft weicher Hügel.
Thomas Schüttes Serie der "Frauen" knüpft an diese lange Geschichte des weiblichen Aktes an und befragt zugleich dessen heutige Bedeutung.
Darüber hinaus muss die Werkreihe auch vor dem Hintergrund deutscher Nachkriegskunst gelesen werden. Nach dem Missbrauch figürlicher Darstellungen durch faschistische Regime stellte sich die Frage, ob eine Fortführung der Figuration überhaupt möglich sei. Schütte gelingt es, diese Tradition nicht zu verleugnen, sondern in eine neue, kritische Form zu überführen. Seine Skulpturen sind weder rein konservativ noch bloß destruktiv, sondern eröffnen ein Terrain, auf dem die Möglichkeiten figurativer Kunst neu verhandelt werden können.
"Bronzefrau Nr. 12" ist somit nicht nur eine Darstellung des weiblichen Körpers, sondern ein Reflexionsraum über Skulptur an sich: über Material, Maßstab, Präsentation und historische Bezüge. Schüttes Kunst erhebt keinen Anspruch auf endgültige Antworten – sie formuliert Fragen, die offen bleiben, und eröffnet so einen Raum, in dem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Skulptur neu verbinden. [EH]
"Frauen" in Ausstellungen
Mit der Serie der "Frauen", einem Schlüsselwerk innerhalb seines Œuvres, hat Thomas Schütte in den vergangenen Jahren weltweit in bedeutenden Einzelausstellungen Maßstäbe gesetzt.
2025: Gagosian Gallery, New York.
2024/25: The Museum of Modern Art, New York.
2019 Kunsthaus Bregenz.
2016: Moderna Museet, Stockholm.
2013: Fondation Beyeler, Riehen/Basel.
2014: Museum Folkwang, Essen.
2013/14: me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht.
2013: Sara Hildén Art Museum, Tampere.
2012: Castello di Rivoli, Turin.
2010: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
2009: Haus der Kunst, München.
125001222
Thomas Schütte
Bronzefrau Nr. 12, 2003.
Bronze patiniert, auf einem Stahl-Tisch
Schätzpreis: € 1.000.000 - 1.500.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Undine Schleifer
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.