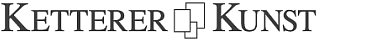Auktion: 600 / Evening Sale am 05.12.2025 in München  Lot 125001298
Lot 125001298
 Lot 125001298
Lot 125001298
125001298
Paula Modersohn-Becker
Brustbild eines Mädchens in der Dämmerung, 1901.
Öltempera auf Malpappe
Schätzpreis: € 100.000 - 150.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Paula Modersohn-Becker
1876 - 1907
Brustbild eines Mädchens in der Dämmerung. 1901.
Öltempera auf Malpappe.
Verso datiert "Aug. 1901". 55,5 x 40,2 cm (21,8 x 15,8 in). [CH].
• Einnehmendes, frontalansichtiges Porträt von 1901, ein Jahr nach Modersohn-Beckers erster Parisreise.
• In der warmen Tonalität liegen Einflüsse der französischen Avantgarde, doch die direkte, ausdrucksstarke Bildsprache ist eigenständig und bereits unverwechselbar.
• Bereits 1920 erstmals publiziert.
• 2024/25 findet die erste große Museumsretrospektive in den USA statt: Neue Galerie, New York u. Art Institute of Chicago.
PROVENIENZ: Adolf von Hatzfeld (1892-1957), München/Düsseldorf (um 1919).
Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München (1920).
Privatsammlung USA (um 1950 in Hamburg erworben).
Privatsammlung Hamburg (1981).
Privatsammlung.
Kunsthandel Wolfgang Werner, Bremen/Berlin.
Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (vom Vorgenannten erworben).
LITERATUR: Günter Busch, Milena Schicketanz, Wolfgang Werner, Paula Modersohn-Becker 1876-1907. Werkverzeichnis der Gemälde, Bd. II, München 1998, WVZ-Nr. 191 (m. SW-Abb.).
- -
Mitteilungen der Galerie "Neue Kunst" und des "Goltzverlages", in: Der Ararat, 1. Jg., Dez. 1920, H. 11/12, S. 174 (m. Abb.).
Galerie Wolfgang Ketterer, München, 28. Auktion, 1981, Los 970 (m. Farbabb.).
Hauswedell & Nolte, Hamburg, 249. Auktion, 1983, Los 987 (m. Farbabb.).
1876 - 1907
Brustbild eines Mädchens in der Dämmerung. 1901.
Öltempera auf Malpappe.
Verso datiert "Aug. 1901". 55,5 x 40,2 cm (21,8 x 15,8 in). [CH].
• Einnehmendes, frontalansichtiges Porträt von 1901, ein Jahr nach Modersohn-Beckers erster Parisreise.
• In der warmen Tonalität liegen Einflüsse der französischen Avantgarde, doch die direkte, ausdrucksstarke Bildsprache ist eigenständig und bereits unverwechselbar.
• Bereits 1920 erstmals publiziert.
• 2024/25 findet die erste große Museumsretrospektive in den USA statt: Neue Galerie, New York u. Art Institute of Chicago.
PROVENIENZ: Adolf von Hatzfeld (1892-1957), München/Düsseldorf (um 1919).
Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München (1920).
Privatsammlung USA (um 1950 in Hamburg erworben).
Privatsammlung Hamburg (1981).
Privatsammlung.
Kunsthandel Wolfgang Werner, Bremen/Berlin.
Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (vom Vorgenannten erworben).
LITERATUR: Günter Busch, Milena Schicketanz, Wolfgang Werner, Paula Modersohn-Becker 1876-1907. Werkverzeichnis der Gemälde, Bd. II, München 1998, WVZ-Nr. 191 (m. SW-Abb.).
- -
Mitteilungen der Galerie "Neue Kunst" und des "Goltzverlages", in: Der Ararat, 1. Jg., Dez. 1920, H. 11/12, S. 174 (m. Abb.).
Galerie Wolfgang Ketterer, München, 28. Auktion, 1981, Los 970 (m. Farbabb.).
Hauswedell & Nolte, Hamburg, 249. Auktion, 1983, Los 987 (m. Farbabb.).
Die hier angebotene Arbeit entsteht um 1901, zu einer im Leben der Künstlerin sehr ereignisreichen Zeit. Zwischen Januar und Juni 1900 weilt sie erstmals, ebenso wie ihre enge Freundin Clara Westhoff, einige Monate in der von ihr so geschätzten Stadt Paris und besucht die private Académie Colarossi. Erst im Juli kehrt sie nach Worpswede zurück, im September folgt die Verlobung mit Otto Modersohn, den sie im Mai des darauffolgenden Jahres 1901 heiratet. In diesem Sommer entstehen einige Figurenbildnisse, in denen Modersohn-Becker die Dargestellten frontal und unmittelbar vor Worpsweder Landschaft in Szene setzt. Es dominiert die Gestalt, die Landschaft rahmt und umschließt. Die Künstlerin rückt die Personen nah an die Betrachter heran, zeigt sie stark abstrahiert in freiem Farbauftrag und breitem, deutlich sichtbaren Pinselduktus mit entrücktem, in die Ferne gerichteten Blick. Die Figur behält zwar ihren stillen, individuellen Charakter, wird aber aus dem Alltäglichen herausgehoben – ein typisches Merkmal auch für die späteren Figurenbildnisse der Künstlerin.
Modersohn-Becker vermeidet die konventionelle Schönheit und künstlerische Konventionen im Allgemeinen. Stattdessen malt sie die Worpsweder Mädchen in einer Art und Weise, die traditionelle Vorstellungen von kindlichem, adrettem Liebreiz in Frage stellt, ganz ohne Idealisierung oder Beschönigung und fernab der üblichen Putto-ähnlichen Darstellungen. Kopf und Körper sind nicht mehr klar definiert, die Gesichtszüge entindividualisiert. Die Künstlerin strebt nach größtmöglicher Einfachheit, beschreibende Details werden unterdrückt: "Die große Einfachheit der Form, das ist etwas Wunderbares. Von jeher habe ich mich bemüht, den Köpfen, die ich malte oder zeichnete, die Einfachheit der Natur zu verleihen. Jetzt fühle ich tief, wie ich an den Köpfen der Antike lernen kann. Wie sind die groß und einfach gesehen! Stirn, Augen, Mund, Nase, Wangen, Kinn, das ist alles. Es klingt so einfach und ist doch so sehr, sehr viel.“ (PMB, Tagebucheintrag, Februar 1903, in: Günter Busch u. Liselotte von Reinken (Hrsg.), Paula Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern, Frankfurt a. M. 2007, S. 140)
In "Brustbild eines Mädchens in der Dämmerung" geht Modersohn-Becker in der Abstrahierung und Vereinfachung noch einen Schritt weiter: Immer stärker geht es ihr darum, Übliches zu überwinden, das Alltägliche und Vertraute zu verfremden und Distanz zwischen Dargestellten und Betrachtern aufzubauen. Die mädchenhaften Gesichtszüge stellt sie verschwommen und stark schematisiert dar, sodass sie fast ins Maskenhafte abgleiten. Sie spielt mit Ungeraden und Asymmetrien und nimmt der Komposition damit und auch mithilfe des freien, malerischen Farbauftrags jegliche Starrheit. Ihr neuartiges künstlerisches Vorhaben eckt an und erntet viel Kritik. 1903 urteilt ihr Ehemann Otto Modersohn: "Paula haßt das Konventionelle [...] und fällt nun auf den Fehler, alles lieber eckig, häßlich, bizarr, hölzern zu machen! Die Farbe ist famos – aber die Form? Der Ausdruck! Hände wie Löffel, Nasen wie Kolben, Münder wie Wunden, Ausdruck von Cretins. Sie ladet sich zu viel auf. [...] Rat kann man ihr schwer erteilen, wie meistens." (Otto Modersohn, Tagebuch, 1903, zit. nach: Paula Modersohn-Becker-Stiftung (Hrsg.), Paula Modersohn-Becker. Die Gemälde aus den drei Bremer Sammlungen, Bremen 2008, S. 90)
Nach ihrem viel zu frühen Tod unterstellen ihr auch die "Kulturpolitiker" der nationalsozialistischen Regierung in den 1930er und 1940er Jahren, sie habe bewusst das Hässliche und Degenerierte gesucht und erklären sie zur "entarteten" Künstlerin.
Ungeachtet ihrer Kritiker ist es Paula Modersohn-Becker in nur wenigen Schaffensjahren gelungen, mit unangepasster künstlerischer Haltung, progressiven Stilmitteln und radikalen Schöpfungen ihre ganz eigene Bildsprache zu entwickeln und einen festen Platz in der Moderne zu erobern. [CH]
Modersohn-Becker vermeidet die konventionelle Schönheit und künstlerische Konventionen im Allgemeinen. Stattdessen malt sie die Worpsweder Mädchen in einer Art und Weise, die traditionelle Vorstellungen von kindlichem, adrettem Liebreiz in Frage stellt, ganz ohne Idealisierung oder Beschönigung und fernab der üblichen Putto-ähnlichen Darstellungen. Kopf und Körper sind nicht mehr klar definiert, die Gesichtszüge entindividualisiert. Die Künstlerin strebt nach größtmöglicher Einfachheit, beschreibende Details werden unterdrückt: "Die große Einfachheit der Form, das ist etwas Wunderbares. Von jeher habe ich mich bemüht, den Köpfen, die ich malte oder zeichnete, die Einfachheit der Natur zu verleihen. Jetzt fühle ich tief, wie ich an den Köpfen der Antike lernen kann. Wie sind die groß und einfach gesehen! Stirn, Augen, Mund, Nase, Wangen, Kinn, das ist alles. Es klingt so einfach und ist doch so sehr, sehr viel.“ (PMB, Tagebucheintrag, Februar 1903, in: Günter Busch u. Liselotte von Reinken (Hrsg.), Paula Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern, Frankfurt a. M. 2007, S. 140)
In "Brustbild eines Mädchens in der Dämmerung" geht Modersohn-Becker in der Abstrahierung und Vereinfachung noch einen Schritt weiter: Immer stärker geht es ihr darum, Übliches zu überwinden, das Alltägliche und Vertraute zu verfremden und Distanz zwischen Dargestellten und Betrachtern aufzubauen. Die mädchenhaften Gesichtszüge stellt sie verschwommen und stark schematisiert dar, sodass sie fast ins Maskenhafte abgleiten. Sie spielt mit Ungeraden und Asymmetrien und nimmt der Komposition damit und auch mithilfe des freien, malerischen Farbauftrags jegliche Starrheit. Ihr neuartiges künstlerisches Vorhaben eckt an und erntet viel Kritik. 1903 urteilt ihr Ehemann Otto Modersohn: "Paula haßt das Konventionelle [...] und fällt nun auf den Fehler, alles lieber eckig, häßlich, bizarr, hölzern zu machen! Die Farbe ist famos – aber die Form? Der Ausdruck! Hände wie Löffel, Nasen wie Kolben, Münder wie Wunden, Ausdruck von Cretins. Sie ladet sich zu viel auf. [...] Rat kann man ihr schwer erteilen, wie meistens." (Otto Modersohn, Tagebuch, 1903, zit. nach: Paula Modersohn-Becker-Stiftung (Hrsg.), Paula Modersohn-Becker. Die Gemälde aus den drei Bremer Sammlungen, Bremen 2008, S. 90)
Nach ihrem viel zu frühen Tod unterstellen ihr auch die "Kulturpolitiker" der nationalsozialistischen Regierung in den 1930er und 1940er Jahren, sie habe bewusst das Hässliche und Degenerierte gesucht und erklären sie zur "entarteten" Künstlerin.
Ungeachtet ihrer Kritiker ist es Paula Modersohn-Becker in nur wenigen Schaffensjahren gelungen, mit unangepasster künstlerischer Haltung, progressiven Stilmitteln und radikalen Schöpfungen ihre ganz eigene Bildsprache zu entwickeln und einen festen Platz in der Moderne zu erobern. [CH]
125001298
Paula Modersohn-Becker
Brustbild eines Mädchens in der Dämmerung, 1901.
Öltempera auf Malpappe
Schätzpreis: € 100.000 - 150.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Undine Schleifer
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.