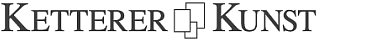Auktion: 600 / Evening Sale am 05.12.2025 in München  Lot 125001428
Lot 125001428
 Lot 125001428
Lot 125001428
Weitere Abbildung
125001428
Robert Motherwell
Open # 184, 1969.
Acryl und Holzkohle auf Leinwand
Schätzpreis: € 400.000 - 600.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Robert Motherwell
1915 - 1991
Open # 184. 1969.
Acryl und Holzkohle auf Leinwand.
Links oben signiert und datiert. Verso signiert, datiert und betitelt. 225 x 310 cm (88,5 x 122 in).
• Ikonen des amerikanischen Post-War: Motherwells Gemälde der "Open Series" und der Werkreihe "Elegy to the Spanish Republic".
• Die monumentalen Gemälde der "Open Series" sind auf dem europäischen Auktionsmarkt eine absolute Seltenheit.
• "Open #184": monumental, museal, intellektuell, verdichtet.
• Weitere Gemälde der "Open Series" befinden sich in den wichtigsten Museumssammlungen, u. a. im Whitney Museum of American Art und im Museum Of Modern Art, New York, sowie im San Fancisco Museum of Modern Art.
• Seit fast 40 Jahren Teil einer europäischen Privatsammlung mit herausragenden Positionen amerikanischer Nachkriegskunst.
PROVENIENZ: Andrew Crispo Gallery, New York.
David Mirvish Gallery, Toronto.
Privatsammlung (seit 1986, Sotheby's).
AUSSTELLUNG: Neues Museum Weserburg, Bremen (Dauerleihgabe, seit 1991, auf der Rückwand mit dem Etikett).
Marca-Relli und die Maler des abstrakten Expressionismus in den USA, Mathildenhöhe Darmstadt, 12.3.-1.5.2000, S. 32, Nr. 25.
Onnasch. Aspects of Contemporary Art, MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, 7.11.2001-24.2.2002 (auf der Rückwand mit dem Etikett).
Onnasch. Aspects of Contemporary Art, Museu Serralves, Porto, 22.3.-23.6.2002.
LITERATUR: Jack Flam, Katy Rogers und Tim Clifford, Robert Motherwell, Paintings and Collages. A Catalogue Raisonné, 1941-1991, Bd. 2, New Haven/London 2012, S. 278, WVZ-Nr. P508.
- -
Bernhard Kerber, Bestände Onnasch, Berlin 1992, S. 31.
Onnasch. Aspects of Contemporary Art, MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona 2001, S. 59.
Sotheby's, New York, Contemporary Art, Part I, 5.5.1986, Los 12.
1915 - 1991
Open # 184. 1969.
Acryl und Holzkohle auf Leinwand.
Links oben signiert und datiert. Verso signiert, datiert und betitelt. 225 x 310 cm (88,5 x 122 in).
• Ikonen des amerikanischen Post-War: Motherwells Gemälde der "Open Series" und der Werkreihe "Elegy to the Spanish Republic".
• Die monumentalen Gemälde der "Open Series" sind auf dem europäischen Auktionsmarkt eine absolute Seltenheit.
• "Open #184": monumental, museal, intellektuell, verdichtet.
• Weitere Gemälde der "Open Series" befinden sich in den wichtigsten Museumssammlungen, u. a. im Whitney Museum of American Art und im Museum Of Modern Art, New York, sowie im San Fancisco Museum of Modern Art.
• Seit fast 40 Jahren Teil einer europäischen Privatsammlung mit herausragenden Positionen amerikanischer Nachkriegskunst.
PROVENIENZ: Andrew Crispo Gallery, New York.
David Mirvish Gallery, Toronto.
Privatsammlung (seit 1986, Sotheby's).
AUSSTELLUNG: Neues Museum Weserburg, Bremen (Dauerleihgabe, seit 1991, auf der Rückwand mit dem Etikett).
Marca-Relli und die Maler des abstrakten Expressionismus in den USA, Mathildenhöhe Darmstadt, 12.3.-1.5.2000, S. 32, Nr. 25.
Onnasch. Aspects of Contemporary Art, MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, 7.11.2001-24.2.2002 (auf der Rückwand mit dem Etikett).
Onnasch. Aspects of Contemporary Art, Museu Serralves, Porto, 22.3.-23.6.2002.
LITERATUR: Jack Flam, Katy Rogers und Tim Clifford, Robert Motherwell, Paintings and Collages. A Catalogue Raisonné, 1941-1991, Bd. 2, New Haven/London 2012, S. 278, WVZ-Nr. P508.
- -
Bernhard Kerber, Bestände Onnasch, Berlin 1992, S. 31.
Onnasch. Aspects of Contemporary Art, MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona 2001, S. 59.
Sotheby's, New York, Contemporary Art, Part I, 5.5.1986, Los 12.
Robert Motherwell – Philosoph und Titan des Abstrakten Expressionismus sowie der New York School
"The death of Robert Motherwell [...] marks the final guttering out of the lamp of American painting’s most heroic generation. Now only Willem de Kooning remains among the titans of Abstract Expressionism […]", war in der Los Angeles Times 1991 anlässlich von Robert Motherwells Tod zu lesen. Zweifelsohne zählt Motherwell neben Jackson Pollock, Willem de Kooning oder Helen Frankenthaler zu den großen Heroen der amerikanischen Malerei. Heute als New York School gefeiert, waren diese Künstler für die Malerei des Abstrakten Expressionismus und des Colour Field Painting in entscheidender Weise prägend. Dieser radikale Aufbruch, der sich um die Jahrhundertmitte in der amerikanischen Kunstmetropole New York vollzog, sollte Amerika erstmals zum Mittelpunkt einer international gefeierten Kunstbewegung werden lassen, zu deren Protagonisten Robert Motherwell zählt.
Aus einer schottisch-irischen Einwandererfamilie stammend, war Motherwell musisch und literarisch interessiert. Bereits in jungen Jahren liebte er Bach, Haydn und Mozart und war fasziniert von Baudelaire und Proust. Er besuchte die Stanford University und wechselte anschließend nach Harvard, um dort in Philosophie zu promovieren. Motherwell kam 1940 nach New York und wurde in den Folgejahren zu einer Art kosmopolitischen Intellektuellen des Abstrakten Expressionismus, weit gereist, schwer belesen und ernsthaft an philosophischen und kunsttheoretischen Fragestellungen interessiert. 1951 veröffentlicht er im Kontext eines Symposiums anlässlich seiner Beteiligung an der Ausstellung "Abstract Painting and Sculpture in America" im Museum of Modern Art in New York seinen legendären Aufsatz "What abstract art means to me", in dem er den künstlerischen Schaffensprozess als mystischen Akt, eine geheimnisvolle spirituelle Erfahrung beschreibt, welche den Künstler aus einem defizitären Gefühl der Unverbundenheit heraus antreibe:
"But whatever the source of this sense of being unwedded to the universe, I think that one’s art is just one’s effort to wed oneself to the universe, to unify oneself through union. [...] If this suggestion is true, then modern art has a different face from the art of the past because it has a somewhat different function for the artist in our time. […] One of the most striking aspects of abstract art’s appearance is her nakedness, an art stripped bare. […] One might almost legitimately receive the impression that abstract artists don’t like anything but the act of painting ...
[…] abstract art is a form of mysticism. […] I love painting the way one loves the body of woman, that if painting must have an intellectual and social background, it is only to enhance and make more rich an essentially warm, simple, radiant act, for which everyone has a need ..."
Robert Motherwell, What abstract art means to me, 1951.
"Elegy to the Spanish Republic" – Zeitlose Metapher für Leben und Tod, Werden und Vergehen
Gerade bei Motherwell zeigt sich in aller Deutlichkeit die zentrale Bedeutung, welche die charakterliche Veranlagung des Künstlers für den Stil und die individuelle Wirkmacht seiner malerischen Schöpfungen hat. Bei Motherwell zeichnet sie sich durch eine geradezu poetisch-intellektuelle Aura aus. Bereits 1948 beginnt er, damals gerade Anfang 30, mit seiner berühmten, über 200 Gemälde umfassenden Serie "Elegy to the Spanish Republic". Die Gräueltaten des spanischen Bürgerkrieges im Jahr 1936, die auch Picasso zu seinem Gemälde "Guernica" (1937) inspiriert hatten, haben ebenso bei dem damals erst 21-jährigen Motherwell einen so entscheidenden Eindruck hinterlassen, dass er mehr als zehn Jahre später und damit zudem in Anschluss an die Grauen des Zweiten Weltkrieges beginnt, diese prägenden existenziellen Erfahrungen zwischen Tod und Leben künstlerisch zu verarbeiten. Motherwells in großen malerischen Gesten auf die Leinwand gebannte Anspielung auf die Sterblichkeit des Menschen zeigt seine Bewunderung für den französischen Symbolismus, eine Wertschätzung, die er mit seinen Künstlerkollegen des Abstrakten Expressionismus teilt. Das abstrakte, in fast allen "Elegys" wiederkehrende Motiv, ein abwechselndes Muster aus bauchigen Formen, die zwischen säulenartigen Formen gedrängt sind, kann als Ausdruck von Verlust und Widerstand gelesen werden. Die Gegenüberstellung von schwarzen Formen und weißem Grund erscheint zudem wie ein Sinnbild der Dialektik von Leben und Tod. Zu dieser zwischen 1948 und 1971 geschaffenen Werkreihe hat Motherwell selbst konstatiert: "After a period of painting them, I discovered Black as one of my subjects – and with black, the contrasting white, a sense of life and death which to me is quite Spanish." (zit. nach: https://www.guggenheim.org/artwork/3047). Motherwells Anspielung auf die Sterblichkeit des Menschen in Form von abstrakten Kürzeln und wiederkehrenden Motiven, durch eine nicht-referenzielle Bildsprache lässt seine Bewunderung für den französischen Symbolismus erkennen. Motherwell war besonders inspiriert von der Überzeugung des symbolistischen Dichters Stéphane Mallarmé, dass ein Gedicht nicht eine bestimmte Entität, Idee oder ein bestimmtes Ereignis darstellen sollte, sondern vielmehr die emotionale Wirkung, die es hervorruft. Und so sind Motherwells "Elegys to the Spanish Republic" ästhetisch anspruchsvolle und zeitlose Metaphern für den Gegensatz von Leben und Tod und der existenziellen und ewigen Wechselbeziehung von Werden und Vergehen.
Motherwells "Open # 184" – Intellektuell verdichtete Ikone des amerikanischen Post-War
Parellel zu den "Elegys" beginnt Motherwell, der seit Ende 1958 mit Helen Frankentaler verheiratet ist, 1967 mit einer weiteren wichtigen Werkreihe, der "Open"-Serie (1967–1969), zu der auch die vorliegende, großformatige Komposition "Open #184" zählt. Diese wegweisenden Arbeiten markieren einen wichtigen Wendepunkt in Motherwells Oeuvre, denn in der ausgesprochen mutigen Ästhetik der monumentalen Leinwände ist es Motherwell gelungen, Elemente der Minimal-Art für seine epochale und emotional wie intellektuell aufgeladene Malerei zu nutzen. Souverän und mutig hat er die klar umrissenen Linien in schwarzer Kohle ins Format gesetzt und die Leinwand in einem ersten Schritt in eine sanfte, flächig aufgebrachte Farbnuance getaucht, die – wie auch die gestisch ausgeführten Farbakzente – den Pinselduktus in den Fokus rückt. Geradezu tänzerisch verschmilzt Motherwell hier zeichnerische und malerische Elemente auf der gewaltigen Leinwandfläche zu einer vollkommen neuartigen Ästhetik, die aufgrund der Sparsamkeit ihrer malerischen Mittel eine fesselnde, geradezu spirituelle Aura umgibt. Die entscheidende Inspiration für die "Open"-Werkreihe war ein eigentlich nebensächliches Ereignis in Motherwells Studio, in dem damals eine kleinere Leinwand gegen eine größere lehnte und der Künstler plötzlich realisierte, wie die kleine Leinwand scheinbar beiläufig den Umriss einer Tür oder eines Fensters auf der größeren Leinwandfläche entstehen lässt. Die lediglich in ihren Umrissen angedeutete Tür- oder Fensteröffnung wird als Metapher für den Übergang zwischen Innen und Außen, zwischen Körper und Psyche, zwischen physischer und metaphysischer Welt zum zentralen Motiv dieser Werkserie. Einmal mehr zeigt sich in der formalen Komprimierung, Verdichtung und Wiederholung eines malerischen Motivs Motherwells herausragende intellektuelle wie malerische Meisterschaft.
Dieser zufällige Moment, diese flüchtige Beobachtung sollte also der entscheidende Schlüsselmoment für die Werkreihe "Open" sein, die heute zu den Ikonen der amerikanischen Nachkriegsmalerei zählt. Wie flüchtige, zeichnerische Silhouetten im Riesenformat wirken diese radikal modernen Schöpfungen, die sich heute – wie auch die Gemälde der Serie "Elegy to the Spanish Republic" – in den besten Museumssammlungen befinden, darunter das Whitney Museum of American Art (Open # 101, 1968/69) und das Museum of Modern Art, New York (Open #24, 1968), sowie das San Francisco Museum of Modern Art (Open #124, 1969). [JS]
"The death of Robert Motherwell [...] marks the final guttering out of the lamp of American painting’s most heroic generation. Now only Willem de Kooning remains among the titans of Abstract Expressionism […]", war in der Los Angeles Times 1991 anlässlich von Robert Motherwells Tod zu lesen. Zweifelsohne zählt Motherwell neben Jackson Pollock, Willem de Kooning oder Helen Frankenthaler zu den großen Heroen der amerikanischen Malerei. Heute als New York School gefeiert, waren diese Künstler für die Malerei des Abstrakten Expressionismus und des Colour Field Painting in entscheidender Weise prägend. Dieser radikale Aufbruch, der sich um die Jahrhundertmitte in der amerikanischen Kunstmetropole New York vollzog, sollte Amerika erstmals zum Mittelpunkt einer international gefeierten Kunstbewegung werden lassen, zu deren Protagonisten Robert Motherwell zählt.
Aus einer schottisch-irischen Einwandererfamilie stammend, war Motherwell musisch und literarisch interessiert. Bereits in jungen Jahren liebte er Bach, Haydn und Mozart und war fasziniert von Baudelaire und Proust. Er besuchte die Stanford University und wechselte anschließend nach Harvard, um dort in Philosophie zu promovieren. Motherwell kam 1940 nach New York und wurde in den Folgejahren zu einer Art kosmopolitischen Intellektuellen des Abstrakten Expressionismus, weit gereist, schwer belesen und ernsthaft an philosophischen und kunsttheoretischen Fragestellungen interessiert. 1951 veröffentlicht er im Kontext eines Symposiums anlässlich seiner Beteiligung an der Ausstellung "Abstract Painting and Sculpture in America" im Museum of Modern Art in New York seinen legendären Aufsatz "What abstract art means to me", in dem er den künstlerischen Schaffensprozess als mystischen Akt, eine geheimnisvolle spirituelle Erfahrung beschreibt, welche den Künstler aus einem defizitären Gefühl der Unverbundenheit heraus antreibe:
"But whatever the source of this sense of being unwedded to the universe, I think that one’s art is just one’s effort to wed oneself to the universe, to unify oneself through union. [...] If this suggestion is true, then modern art has a different face from the art of the past because it has a somewhat different function for the artist in our time. […] One of the most striking aspects of abstract art’s appearance is her nakedness, an art stripped bare. […] One might almost legitimately receive the impression that abstract artists don’t like anything but the act of painting ...
[…] abstract art is a form of mysticism. […] I love painting the way one loves the body of woman, that if painting must have an intellectual and social background, it is only to enhance and make more rich an essentially warm, simple, radiant act, for which everyone has a need ..."
Robert Motherwell, What abstract art means to me, 1951.
"Elegy to the Spanish Republic" – Zeitlose Metapher für Leben und Tod, Werden und Vergehen
Gerade bei Motherwell zeigt sich in aller Deutlichkeit die zentrale Bedeutung, welche die charakterliche Veranlagung des Künstlers für den Stil und die individuelle Wirkmacht seiner malerischen Schöpfungen hat. Bei Motherwell zeichnet sie sich durch eine geradezu poetisch-intellektuelle Aura aus. Bereits 1948 beginnt er, damals gerade Anfang 30, mit seiner berühmten, über 200 Gemälde umfassenden Serie "Elegy to the Spanish Republic". Die Gräueltaten des spanischen Bürgerkrieges im Jahr 1936, die auch Picasso zu seinem Gemälde "Guernica" (1937) inspiriert hatten, haben ebenso bei dem damals erst 21-jährigen Motherwell einen so entscheidenden Eindruck hinterlassen, dass er mehr als zehn Jahre später und damit zudem in Anschluss an die Grauen des Zweiten Weltkrieges beginnt, diese prägenden existenziellen Erfahrungen zwischen Tod und Leben künstlerisch zu verarbeiten. Motherwells in großen malerischen Gesten auf die Leinwand gebannte Anspielung auf die Sterblichkeit des Menschen zeigt seine Bewunderung für den französischen Symbolismus, eine Wertschätzung, die er mit seinen Künstlerkollegen des Abstrakten Expressionismus teilt. Das abstrakte, in fast allen "Elegys" wiederkehrende Motiv, ein abwechselndes Muster aus bauchigen Formen, die zwischen säulenartigen Formen gedrängt sind, kann als Ausdruck von Verlust und Widerstand gelesen werden. Die Gegenüberstellung von schwarzen Formen und weißem Grund erscheint zudem wie ein Sinnbild der Dialektik von Leben und Tod. Zu dieser zwischen 1948 und 1971 geschaffenen Werkreihe hat Motherwell selbst konstatiert: "After a period of painting them, I discovered Black as one of my subjects – and with black, the contrasting white, a sense of life and death which to me is quite Spanish." (zit. nach: https://www.guggenheim.org/artwork/3047). Motherwells Anspielung auf die Sterblichkeit des Menschen in Form von abstrakten Kürzeln und wiederkehrenden Motiven, durch eine nicht-referenzielle Bildsprache lässt seine Bewunderung für den französischen Symbolismus erkennen. Motherwell war besonders inspiriert von der Überzeugung des symbolistischen Dichters Stéphane Mallarmé, dass ein Gedicht nicht eine bestimmte Entität, Idee oder ein bestimmtes Ereignis darstellen sollte, sondern vielmehr die emotionale Wirkung, die es hervorruft. Und so sind Motherwells "Elegys to the Spanish Republic" ästhetisch anspruchsvolle und zeitlose Metaphern für den Gegensatz von Leben und Tod und der existenziellen und ewigen Wechselbeziehung von Werden und Vergehen.
Motherwells "Open # 184" – Intellektuell verdichtete Ikone des amerikanischen Post-War
Parellel zu den "Elegys" beginnt Motherwell, der seit Ende 1958 mit Helen Frankentaler verheiratet ist, 1967 mit einer weiteren wichtigen Werkreihe, der "Open"-Serie (1967–1969), zu der auch die vorliegende, großformatige Komposition "Open #184" zählt. Diese wegweisenden Arbeiten markieren einen wichtigen Wendepunkt in Motherwells Oeuvre, denn in der ausgesprochen mutigen Ästhetik der monumentalen Leinwände ist es Motherwell gelungen, Elemente der Minimal-Art für seine epochale und emotional wie intellektuell aufgeladene Malerei zu nutzen. Souverän und mutig hat er die klar umrissenen Linien in schwarzer Kohle ins Format gesetzt und die Leinwand in einem ersten Schritt in eine sanfte, flächig aufgebrachte Farbnuance getaucht, die – wie auch die gestisch ausgeführten Farbakzente – den Pinselduktus in den Fokus rückt. Geradezu tänzerisch verschmilzt Motherwell hier zeichnerische und malerische Elemente auf der gewaltigen Leinwandfläche zu einer vollkommen neuartigen Ästhetik, die aufgrund der Sparsamkeit ihrer malerischen Mittel eine fesselnde, geradezu spirituelle Aura umgibt. Die entscheidende Inspiration für die "Open"-Werkreihe war ein eigentlich nebensächliches Ereignis in Motherwells Studio, in dem damals eine kleinere Leinwand gegen eine größere lehnte und der Künstler plötzlich realisierte, wie die kleine Leinwand scheinbar beiläufig den Umriss einer Tür oder eines Fensters auf der größeren Leinwandfläche entstehen lässt. Die lediglich in ihren Umrissen angedeutete Tür- oder Fensteröffnung wird als Metapher für den Übergang zwischen Innen und Außen, zwischen Körper und Psyche, zwischen physischer und metaphysischer Welt zum zentralen Motiv dieser Werkserie. Einmal mehr zeigt sich in der formalen Komprimierung, Verdichtung und Wiederholung eines malerischen Motivs Motherwells herausragende intellektuelle wie malerische Meisterschaft.
Dieser zufällige Moment, diese flüchtige Beobachtung sollte also der entscheidende Schlüsselmoment für die Werkreihe "Open" sein, die heute zu den Ikonen der amerikanischen Nachkriegsmalerei zählt. Wie flüchtige, zeichnerische Silhouetten im Riesenformat wirken diese radikal modernen Schöpfungen, die sich heute – wie auch die Gemälde der Serie "Elegy to the Spanish Republic" – in den besten Museumssammlungen befinden, darunter das Whitney Museum of American Art (Open # 101, 1968/69) und das Museum of Modern Art, New York (Open #24, 1968), sowie das San Francisco Museum of Modern Art (Open #124, 1969). [JS]
125001428
Robert Motherwell
Open # 184, 1969.
Acryl und Holzkohle auf Leinwand
Schätzpreis: € 400.000 - 600.000
Informationen zu Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung sind ab vier Wochen vor Auktion verfügbar.
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Undine Schleifer
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.