Video
Rückseite
Rahmenbild
78
Oskar Schlemmer
Jünglingsgruppe in Braun, 1928.
Kunstharz auf Nessel, auf Holz
Schätzung:
€ 280.000 Ergebnis:
€ 322.500 (inklusive Aufgeld)
Oskar Schlemmer
1888 - 1943
Jünglingsgruppe in Braun. 1928.
Kunstharz auf Nessel, auf Holz.
Verso signiert, datiert "Dez 1928", betitelt "Jünglingsgruppe in braun" und bezeichnet "Sperrholz". 69,5 x 30,2 cm (27,3 x 11,8 in).
Vorbereitendes Werk zu den Wandbildern im Museum Folkwang, Essen. Verwandte Studien: siehe Karin v. Maur, Oskar Schlemmer, Bd. II, Oeuvrekatalog der Gemälde, Aquarelle, Pastelle und Plastiken, München 1979, WVZ-Nr. G 167, G 170, die hinführen zu Bild 4 der ersten Fassung, G 177. Dazugehörige Bleistiftskizzen, siehe: Will Grohmann u. Tut Schlemmer, Stuttgart 1965, WVZ-Nr. 228 u. 229 (m. Abb., S. 248).
Das Werk ist in der "Bilderliste der Januarausstellung“, einer handschriftlichen Liste des Künstlers von 1930 unter der Nummer 43 und dem Titel "Braune Jünglingsgruppe 30:70“ zu finden. Ebenso in der vom Künstler überarbeiteten Liste von 1931. [CH].
• Figur im Raum: Die choreografierte Anordnung von Köpfen und Profilen auf unterschiedlichen Ebenen kulminiert wenige Jahre später in der "Bauhaus-Treppe" (1932, Museum of Modern Art, New York).
• Meisterliche Inszenierung von Licht und Schatten, Tiefenwirkung und Plastizität.
• "Jünglingsgruppe in Braun" entsteht im Kontext zu den heute zerstörten Wandbildern im Museum Folkwang, Essen.
• Schlemmers Figurenkompositionen der Bauhaus-Jahre gelten als die gefragtesten Arbeiten des Künstlers auf dem internationalen Auktionsmarkt.
• 1930 sind die Werke Schlemmers Teil der XVII. Biennale in Venedig, 1931 ist er an der großen Überblicksschau "Modern German Painting and Sculpture" im Museum of Modern Art in New York vertreten.
• Bereits 1929 erstmals ausgestellt und seit 45 Jahren Teil einer bedeutenden Berliner Privatsammlung.
Wir danken Herrn C. Raman Schlemmer, The Oskar Schlemmer Estate + Archives, für die freundliche wissenschaftliche Beratung.
Wir danken Herrn Markus H. Stötzel und den Erben nach Alfred Flechtheim für die freundliche Beratung.
PROVENIENZ: Sammlung Dipl. Ing. Karl Wilhelm Zachrich, Freiburg i. Br. (1946 erworben).
"Dr. Kr." (bis 1950).
Galerie Limmer, Freiburg (1978).
Privatsammlung Wuppertal.
Galerie Linssen, Bonn.
Privatsammlung Berlin (1980 vom Vorgenannten erworben).
AUSSTELLUNG: Stuttgarter Neue Sezession, Kunsthaus Schaller, Stuttgart 1929, Listen-Nr. 5 (verso m. d. handschriftl. bez. Etikett, dort m. d. Nr. 153).
Bauhaus Dessau, Kunsthalle Basel, 20.4.-9.5.1929, S. 10, Kat.-Nr. 141 (m. d. Titel "Jünglinge" und d. Bez. "Freskostudie", a. d. Liste d. Künstlers zu dieser Ausst. bez. "Fresko-Studie IV").
Oskar Schlemmer, Kunsthaus Schaller, Stuttgart, Mai bis Juni 1929, Liste Nr. 5, (verso mit dem handschriftl. bezeichneten Etikett: "135 Prof. O. Schlemmer / Jünglingsfiguren in braun“).
Gemälde, Graphik, Plastik, Architektur, Kunstgewerbe, Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe, Breslau, 18.1.-19.2.1930, wohl S. 15, Nr. 20 (m. d. Titel "Fresko-Studie D").
Oskar Schlemmer, Galerie Flechtheim, Berlin, 1931, Listen-Nr. 34 (außer Kat.).
Moderne Kunst aus Freiburger Privatbesitz, Stadthalle, Freiburg i. Br., 12.3.-3.4.1960, Kat.-Nr. 70.
Kunst des 20. Jahrhunderts, Galerie Linssen, Bonn, April bis Juni 1980 (verso mit dem Stempel).
Oskar Schlemmer: Der Folkwang-Zyklus. Malerei um 1930, Staatsgalerie Stuttgart, 11.9.-14.11.1993; Museum Folkwang Essen, 13.12.1993-14.2.1994, S. 158 u. 169, Kat.-Nr. 151 (m. Abb, S. 169, auf dem Rahmen mit dem Etikett).
LITERATUR: Karin v. Maur, Oskar Schlemmer, Bd. II, Oeuvrekatalog der Gemälde, Aquarelle, Pastelle und Plastiken, München 1979, S. 76, WVZ-Nr. G 169 (m. SW-Abb., S. 77).
Hans Hildebrandt, Oskar Schlemmer, München 1952, WVZ-Nr. 147.
- -
Kunsthaus Pfisterer, Freiburg i. Br., I. Große Freiburger Kunst-Auktion, 22./23.3.1950, Los 557.
1888 - 1943
Jünglingsgruppe in Braun. 1928.
Kunstharz auf Nessel, auf Holz.
Verso signiert, datiert "Dez 1928", betitelt "Jünglingsgruppe in braun" und bezeichnet "Sperrholz". 69,5 x 30,2 cm (27,3 x 11,8 in).
Vorbereitendes Werk zu den Wandbildern im Museum Folkwang, Essen. Verwandte Studien: siehe Karin v. Maur, Oskar Schlemmer, Bd. II, Oeuvrekatalog der Gemälde, Aquarelle, Pastelle und Plastiken, München 1979, WVZ-Nr. G 167, G 170, die hinführen zu Bild 4 der ersten Fassung, G 177. Dazugehörige Bleistiftskizzen, siehe: Will Grohmann u. Tut Schlemmer, Stuttgart 1965, WVZ-Nr. 228 u. 229 (m. Abb., S. 248).
Das Werk ist in der "Bilderliste der Januarausstellung“, einer handschriftlichen Liste des Künstlers von 1930 unter der Nummer 43 und dem Titel "Braune Jünglingsgruppe 30:70“ zu finden. Ebenso in der vom Künstler überarbeiteten Liste von 1931. [CH].
• Figur im Raum: Die choreografierte Anordnung von Köpfen und Profilen auf unterschiedlichen Ebenen kulminiert wenige Jahre später in der "Bauhaus-Treppe" (1932, Museum of Modern Art, New York).
• Meisterliche Inszenierung von Licht und Schatten, Tiefenwirkung und Plastizität.
• "Jünglingsgruppe in Braun" entsteht im Kontext zu den heute zerstörten Wandbildern im Museum Folkwang, Essen.
• Schlemmers Figurenkompositionen der Bauhaus-Jahre gelten als die gefragtesten Arbeiten des Künstlers auf dem internationalen Auktionsmarkt.
• 1930 sind die Werke Schlemmers Teil der XVII. Biennale in Venedig, 1931 ist er an der großen Überblicksschau "Modern German Painting and Sculpture" im Museum of Modern Art in New York vertreten.
• Bereits 1929 erstmals ausgestellt und seit 45 Jahren Teil einer bedeutenden Berliner Privatsammlung.
Wir danken Herrn C. Raman Schlemmer, The Oskar Schlemmer Estate + Archives, für die freundliche wissenschaftliche Beratung.
Wir danken Herrn Markus H. Stötzel und den Erben nach Alfred Flechtheim für die freundliche Beratung.
PROVENIENZ: Sammlung Dipl. Ing. Karl Wilhelm Zachrich, Freiburg i. Br. (1946 erworben).
"Dr. Kr." (bis 1950).
Galerie Limmer, Freiburg (1978).
Privatsammlung Wuppertal.
Galerie Linssen, Bonn.
Privatsammlung Berlin (1980 vom Vorgenannten erworben).
AUSSTELLUNG: Stuttgarter Neue Sezession, Kunsthaus Schaller, Stuttgart 1929, Listen-Nr. 5 (verso m. d. handschriftl. bez. Etikett, dort m. d. Nr. 153).
Bauhaus Dessau, Kunsthalle Basel, 20.4.-9.5.1929, S. 10, Kat.-Nr. 141 (m. d. Titel "Jünglinge" und d. Bez. "Freskostudie", a. d. Liste d. Künstlers zu dieser Ausst. bez. "Fresko-Studie IV").
Oskar Schlemmer, Kunsthaus Schaller, Stuttgart, Mai bis Juni 1929, Liste Nr. 5, (verso mit dem handschriftl. bezeichneten Etikett: "135 Prof. O. Schlemmer / Jünglingsfiguren in braun“).
Gemälde, Graphik, Plastik, Architektur, Kunstgewerbe, Staatliche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe, Breslau, 18.1.-19.2.1930, wohl S. 15, Nr. 20 (m. d. Titel "Fresko-Studie D").
Oskar Schlemmer, Galerie Flechtheim, Berlin, 1931, Listen-Nr. 34 (außer Kat.).
Moderne Kunst aus Freiburger Privatbesitz, Stadthalle, Freiburg i. Br., 12.3.-3.4.1960, Kat.-Nr. 70.
Kunst des 20. Jahrhunderts, Galerie Linssen, Bonn, April bis Juni 1980 (verso mit dem Stempel).
Oskar Schlemmer: Der Folkwang-Zyklus. Malerei um 1930, Staatsgalerie Stuttgart, 11.9.-14.11.1993; Museum Folkwang Essen, 13.12.1993-14.2.1994, S. 158 u. 169, Kat.-Nr. 151 (m. Abb, S. 169, auf dem Rahmen mit dem Etikett).
LITERATUR: Karin v. Maur, Oskar Schlemmer, Bd. II, Oeuvrekatalog der Gemälde, Aquarelle, Pastelle und Plastiken, München 1979, S. 76, WVZ-Nr. G 169 (m. SW-Abb., S. 77).
Hans Hildebrandt, Oskar Schlemmer, München 1952, WVZ-Nr. 147.
- -
Kunsthaus Pfisterer, Freiburg i. Br., I. Große Freiburger Kunst-Auktion, 22./23.3.1950, Los 557.
Das "Maß aller Dinge": Der neue Mensch und die menschliche Figur im Raum
Oskar Schlemmer gilt als einer der einflussreichsten und vielseitigsten Künstler des Bauhauses: Während seiner Zeit in Weimar (1921–1925) und in Dessau (1925–1929) ist er nicht nur als Maler, Zeichner und Grafiker tätig, sondern auch als Bildhauer, Bühnenbildner, Choreograf und Theoretiker. Bereits 1921 übernimmt Schlemmer als 'Formmeister' die Leitung der Stein- und Holzbildhauerei, den Unterricht im Akt- und Figurenzeichnen und auch die künstlerische Leitung der Wandmalerei – eine Form der Gestaltung, die ihn in den darauffolgenden Jahren äußerst intensiv beschäftigen sollte.
Mit dem Umzug nach Dessau übernimmt Schlemmer die Leitung der Bauhaus-Bühne und unterrichtet ab 1928 das Fach "Der Mensch". Auch seine Kunst kreist nun fast ausschließlich um die Darstellung des menschlichen Kopfes und Körpers. Unter Verzicht auf individuelle Eigenschaften erarbeitet der Künstler in diesen und den darauffolgenden Jahren stark stilisierte, harmonisch komponierte Figurenstudien mit streng ausgerichteten vertikalen und horizontalen Achsen, die auf einer geometrisierten Körpersprache und Formgebung basieren. Er erhebt den Menschen zum Kern seiner experimentellen Arbeiten und zum "Maß aller Dinge": "Dennoch bleibt ein großes Thema, uralt, ewig neu, Gegenstand und Bildner aller Zeiten: der Mensch, die menschliche Figur. Von ihm ist gesagt, daß er das Maß aller Dinge sei. Wohlan! Architektur ist edelste Meßkunst, verbündet Euch!" (Oskar Schlemmer, Tagebuch, Juli/August 1923, zit. nach: Ausst.-Kat. Oskar Schlemmer. Visionen einer neuen Welt, München 2014, S. 157)

Zeichnungen, Vorstudien, Gemälde: Projekt "Folkwang-Zyklus"
Aufgrund dieser Bestrebungen nach einer stärkeren Vereinigung von Kunst und Architektur verlagern sich Schlemmers künstlerische Projekte mit Skulpturen, Wandreliefs und natürlich Wandmalereien zunehmend in den Raum.
Im Oktober 1928 erhält der Künstler vom damaligen Museumsdirektor Ernst Gosebruch den Auftrag zur Wandgestaltung einer kleinen Rotunde im 1922 eröffneten neuen Museum Folkwang in Essen. Der in deren Mitte platzierte weiße Marmor-Brunnen von Georg Minne soll nun von junger deutscher Gegenwartskunst umgeben werden. Statt der zunächst angedachten Fresko-Technik einigt man sich auf eine Ausgestaltung von neun großformatigen Tafeln à 2,50 x 1,65 Meter für die unteren Wände der Rotunde. Der Auftrag beschäftigt Schlemmer in einem aufwändigen, mehrstufigen Schaffensprozess über drei Jahre hinweg und offenbart heute rückblickend einen wichtigen Stilwandel im Schaffen des Künstlers: weg von den streng tektonischen Bauhausbildern hin zu der aufgelockerten, freien Malweise der späteren Jahre in Breslau.
Letztendlich entstehen drei vollständige Fassungen in voller Größe sowie zahlreiche Skizzen, Vorstudien, Varianten und mit den in Essen gezeigten Folgen eng verwandte Gemälde wie die hier angebotene Arbeit "Jünglingsgruppe in Braun", die von der Werkverzeichnis-Verfasserin Karin v. Maur zu den Vorarbeiten der zwischen Oktober 1928 und April 1929 entstehenden ersten Fassung gezählt wird und zusammen mit weiteren eng verwandten Gemälden (vgl. WVZ G 167, Verbleib unbekannt, G 168 und G 170, Verbleib unbekannt) schließlich in Bild 4 (WVZ G 177) der ersten Fassung des Folkwang-Zyklus gipfelt, das sich heute in der Staatsgalerie Stuttgart befindet.

"Jünglingsgruppe in Braun": Licht und Schatten – Innehalten und Bewegung
Diese erste Fassung besteht aus vier Einzelfiguren und fünf vielfigurigen Darstellungen, in denen Köpfe und Halbfiguren in rhythmischen Reihungen variiert werden. Um den Raum nicht zu überladen, sucht Schlemmer in Technik und Quantität der Malerei das Einfache, zeigt seine so kubischen Körper in gewohnt statuarisch-stilisierter Strenge.
So bestehen auch die Gestalten der "Jünglingsgruppe in Braun" ausschließlich aus gerundeten Formen, Gesichter und Gliedmaßen sind auf simple, zum Teil nur angedeutete, weiche Züge und schemenhafte Silhouetten reduziert.
Die stark angeschnittenen, nur fragmentarisch und fast ausschließlich im Profil gezeigten Köpfe zeigt der Künstler ganz ohne architektonische Verortung, sodass Figur und Raum ein Stück weit miteinander verschmelzen. Fast spielerisch strahlt von Links ein wenig "Licht" auf die fast bühnenartige Szene, das die Figuren in kontrastreiche Licht- und Schattenpartien taucht.
Während die Mehrheit nach links gerichtet scheinbar regungslos verharrt, bringen die untere und obere Figur mit Schräglage und Entfernung einen gewissen Eindruck von Räumlichkeit, Tiefe und Bewegung mit sich. Zudem versetzt Schlemmer die Figuren innerhalb des leeren Raumes ganz offenbar auf verschiedene Höhen – eine choreografierte Anordnung von Köpfen und Profilen auf unterschiedlichen Ebenen, die wenige Jahre später zum einen in der "Zwölfergruppe mit Interieur" (1930, Von der Heydt-Museum, Wuppertal), aber insbesondere auch in der "Bauhaus-Treppe" kulminieren wird (1932, Museum of Modern Art, New York).

Aufstieg und Fall
Die gesamtpolitische Lage Deutschlands und Europas beginnt in diesen Jahren bereits zu kippen. In deutlichen Schritten werden die Auswirkungen der allmählichen Machtübernahme und Einflussnahme durch die Nationalsozialisten auch für Oskar Schlemmer spürbar. 1930 wird seine 1923 für die Weimarer Bauhaus-Ausstellung geschaffene Wandgestaltung auf Befehl der nationalsozialistischen Regierung zerstört, zahlreiche seiner Werke werden aus den deutschen Museen entfernt und einige 1937 in der Ausstellung "Entartete Kunst" in München diffamiert. Auch seine Wandbilder des Folkwang-Zyklus gelten heute als verschollen, nachdem man sie 1933 von den Wänden des Museums entfernt und magaziniert.
Schlemmers Karriere kommt schließlich vollends zum Erliegen.

Die kreative Vision eines großen Künstlers
In seinen Bestrebungen für eine ganzheitlich gebildete Gesellschaft und der gattungsübergreifenden Verbindung von Handwerk und künstlerischer Schaffenskraft vereint sein beeindruckendes Œuvre ganz und gar den Geist und die Ideale des Bauhauses, das für die Formgestaltung und die gesamte künstlerische Entwicklung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägend sein sollte. Für Walter Gropius, Architekt und Gründer des Bauhaus, bleibt Schlemmers große künstlerische Leistung und seine Bedeutung für die Moderne unumstritten: "In den Bildern von Oscar Schlemmer lebt eine neue Raumenergie, die mich immer magisch angezogen hat. Diese Art der architektonischen Interpretation innerhalb des gemalten Raumes – einzigartig bei ihm – muss aus einer tiefen Erfahrung des Phänomens Raum stammen. Es erzeugt eine Vorahnung für eine zukünftige Kultur der Ganzheit im Kopf des Betrachters, eine Kultur, die die Künste wieder vereint. Für mich enthüllt das Werk die kreative Vision eines großen Künstlers, das weiterlebt, obwohl sein Schöpfer gestorben ist." (Walter Gropius, 1953, zit. nach: Ausst.-Kat. Oskar Schlemmer. Das Bauhaus und der Weg in die Moderne, Stuttgart 2019, S. 24) [CH]
Nachdem er den Wettbewerb für die Wandgestaltung im Brunnenraum des Museum Folkwang gewonnen hatte, experimentierte Schlemmer 1928 mit verschiedenen Techniken. In diesem Zusammenhang bezeichnete er die zunächst auf Nessel oder Leinwand ausgeführten Studien als "Fresko-Studie". Die Entwürfe und Gemälde entstanden in seinem Atelier im Meisterhaus am Bauhaus Dessau; dieses Gemälde im Dezember 1928. Der gesamte Zyklus – auch die dritte, endgültige und installierte Fassung von 1930 – schuf er auf Leinwand und zog sie auf Sperrholzplatten auf, jedoch nicht als Fresko.
Als der Künstler die Studien 1929, 1930 und 1931 zu Ausstellungen einsandte, bezeichnete er sie in seinen Listen als Fresken-Studie, versehen mit den Buchstaben A bis D beziehungsweise mit römischen Ziffern. In der Hoffnung, sie als eigenständige Gemälde in Galerien verkaufen zu können, bezeichnete Schlemmer die kleineren Ölbilder verso mit eigenständigen Titeln, die keinen direkten Bezug mehr zum Folkwang-Zyklus aufwiesen.
Zu Lebzeiten des Künstlers wurden seine Gemälde zum Folkwang-Zyklus 1930 in der XVII. Biennale in Venedig und 1931 in der ersten Ausstellung deutscher Avantgarde in "Modern German Painting and Sculpture" im Museum of Modern Art in New York (Katalog S. 34 mit Text) ausgestellt.
Zahlreiche dieser Tafeln, auch von der Version 1928 sowie der Version von 1930 gesamt, wurden von den Nationalsozialisten im Zuge der Aktion "Entartete Kunst" 1937 beschlagnahmt und gelten als verschollen oder zerstört.
© 2025 C. Raman Schlemmer.
Oskar Schlemmer gilt als einer der einflussreichsten und vielseitigsten Künstler des Bauhauses: Während seiner Zeit in Weimar (1921–1925) und in Dessau (1925–1929) ist er nicht nur als Maler, Zeichner und Grafiker tätig, sondern auch als Bildhauer, Bühnenbildner, Choreograf und Theoretiker. Bereits 1921 übernimmt Schlemmer als 'Formmeister' die Leitung der Stein- und Holzbildhauerei, den Unterricht im Akt- und Figurenzeichnen und auch die künstlerische Leitung der Wandmalerei – eine Form der Gestaltung, die ihn in den darauffolgenden Jahren äußerst intensiv beschäftigen sollte.
Mit dem Umzug nach Dessau übernimmt Schlemmer die Leitung der Bauhaus-Bühne und unterrichtet ab 1928 das Fach "Der Mensch". Auch seine Kunst kreist nun fast ausschließlich um die Darstellung des menschlichen Kopfes und Körpers. Unter Verzicht auf individuelle Eigenschaften erarbeitet der Künstler in diesen und den darauffolgenden Jahren stark stilisierte, harmonisch komponierte Figurenstudien mit streng ausgerichteten vertikalen und horizontalen Achsen, die auf einer geometrisierten Körpersprache und Formgebung basieren. Er erhebt den Menschen zum Kern seiner experimentellen Arbeiten und zum "Maß aller Dinge": "Dennoch bleibt ein großes Thema, uralt, ewig neu, Gegenstand und Bildner aller Zeiten: der Mensch, die menschliche Figur. Von ihm ist gesagt, daß er das Maß aller Dinge sei. Wohlan! Architektur ist edelste Meßkunst, verbündet Euch!" (Oskar Schlemmer, Tagebuch, Juli/August 1923, zit. nach: Ausst.-Kat. Oskar Schlemmer. Visionen einer neuen Welt, München 2014, S. 157)

Oskar Schlemmer, Signet Staatliches Bauhaus Weimar, 1922, Archiv Oskar Schlemmer.
Zeichnungen, Vorstudien, Gemälde: Projekt "Folkwang-Zyklus"
Aufgrund dieser Bestrebungen nach einer stärkeren Vereinigung von Kunst und Architektur verlagern sich Schlemmers künstlerische Projekte mit Skulpturen, Wandreliefs und natürlich Wandmalereien zunehmend in den Raum.
Im Oktober 1928 erhält der Künstler vom damaligen Museumsdirektor Ernst Gosebruch den Auftrag zur Wandgestaltung einer kleinen Rotunde im 1922 eröffneten neuen Museum Folkwang in Essen. Der in deren Mitte platzierte weiße Marmor-Brunnen von Georg Minne soll nun von junger deutscher Gegenwartskunst umgeben werden. Statt der zunächst angedachten Fresko-Technik einigt man sich auf eine Ausgestaltung von neun großformatigen Tafeln à 2,50 x 1,65 Meter für die unteren Wände der Rotunde. Der Auftrag beschäftigt Schlemmer in einem aufwändigen, mehrstufigen Schaffensprozess über drei Jahre hinweg und offenbart heute rückblickend einen wichtigen Stilwandel im Schaffen des Künstlers: weg von den streng tektonischen Bauhausbildern hin zu der aufgelockerten, freien Malweise der späteren Jahre in Breslau.
Letztendlich entstehen drei vollständige Fassungen in voller Größe sowie zahlreiche Skizzen, Vorstudien, Varianten und mit den in Essen gezeigten Folgen eng verwandte Gemälde wie die hier angebotene Arbeit "Jünglingsgruppe in Braun", die von der Werkverzeichnis-Verfasserin Karin v. Maur zu den Vorarbeiten der zwischen Oktober 1928 und April 1929 entstehenden ersten Fassung gezählt wird und zusammen mit weiteren eng verwandten Gemälden (vgl. WVZ G 167, Verbleib unbekannt, G 168 und G 170, Verbleib unbekannt) schließlich in Bild 4 (WVZ G 177) der ersten Fassung des Folkwang-Zyklus gipfelt, das sich heute in der Staatsgalerie Stuttgart befindet.

Oskar Schlemmer, Unterricht III, 1929, Öl und Tempera auf Leinwand, Staatsgalerie Stuttgart.
"Jünglingsgruppe in Braun": Licht und Schatten – Innehalten und Bewegung
Diese erste Fassung besteht aus vier Einzelfiguren und fünf vielfigurigen Darstellungen, in denen Köpfe und Halbfiguren in rhythmischen Reihungen variiert werden. Um den Raum nicht zu überladen, sucht Schlemmer in Technik und Quantität der Malerei das Einfache, zeigt seine so kubischen Körper in gewohnt statuarisch-stilisierter Strenge.
So bestehen auch die Gestalten der "Jünglingsgruppe in Braun" ausschließlich aus gerundeten Formen, Gesichter und Gliedmaßen sind auf simple, zum Teil nur angedeutete, weiche Züge und schemenhafte Silhouetten reduziert.
Die stark angeschnittenen, nur fragmentarisch und fast ausschließlich im Profil gezeigten Köpfe zeigt der Künstler ganz ohne architektonische Verortung, sodass Figur und Raum ein Stück weit miteinander verschmelzen. Fast spielerisch strahlt von Links ein wenig "Licht" auf die fast bühnenartige Szene, das die Figuren in kontrastreiche Licht- und Schattenpartien taucht.
Während die Mehrheit nach links gerichtet scheinbar regungslos verharrt, bringen die untere und obere Figur mit Schräglage und Entfernung einen gewissen Eindruck von Räumlichkeit, Tiefe und Bewegung mit sich. Zudem versetzt Schlemmer die Figuren innerhalb des leeren Raumes ganz offenbar auf verschiedene Höhen – eine choreografierte Anordnung von Köpfen und Profilen auf unterschiedlichen Ebenen, die wenige Jahre später zum einen in der "Zwölfergruppe mit Interieur" (1930, Von der Heydt-Museum, Wuppertal), aber insbesondere auch in der "Bauhaus-Treppe" kulminieren wird (1932, Museum of Modern Art, New York).

Oskar Schlemmer, Bauhaustreppe, 1932, Öl auf Leinwand, Museum of Modern Art, New York.
Aufstieg und Fall
Die gesamtpolitische Lage Deutschlands und Europas beginnt in diesen Jahren bereits zu kippen. In deutlichen Schritten werden die Auswirkungen der allmählichen Machtübernahme und Einflussnahme durch die Nationalsozialisten auch für Oskar Schlemmer spürbar. 1930 wird seine 1923 für die Weimarer Bauhaus-Ausstellung geschaffene Wandgestaltung auf Befehl der nationalsozialistischen Regierung zerstört, zahlreiche seiner Werke werden aus den deutschen Museen entfernt und einige 1937 in der Ausstellung "Entartete Kunst" in München diffamiert. Auch seine Wandbilder des Folkwang-Zyklus gelten heute als verschollen, nachdem man sie 1933 von den Wänden des Museums entfernt und magaziniert.
Schlemmers Karriere kommt schließlich vollends zum Erliegen.

Oskar Schlemmer, 1920, Vintage-Print, Museum Folkwang, Essen, Foto: Hugo Erfurth.
Die kreative Vision eines großen Künstlers
In seinen Bestrebungen für eine ganzheitlich gebildete Gesellschaft und der gattungsübergreifenden Verbindung von Handwerk und künstlerischer Schaffenskraft vereint sein beeindruckendes Œuvre ganz und gar den Geist und die Ideale des Bauhauses, das für die Formgestaltung und die gesamte künstlerische Entwicklung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägend sein sollte. Für Walter Gropius, Architekt und Gründer des Bauhaus, bleibt Schlemmers große künstlerische Leistung und seine Bedeutung für die Moderne unumstritten: "In den Bildern von Oscar Schlemmer lebt eine neue Raumenergie, die mich immer magisch angezogen hat. Diese Art der architektonischen Interpretation innerhalb des gemalten Raumes – einzigartig bei ihm – muss aus einer tiefen Erfahrung des Phänomens Raum stammen. Es erzeugt eine Vorahnung für eine zukünftige Kultur der Ganzheit im Kopf des Betrachters, eine Kultur, die die Künste wieder vereint. Für mich enthüllt das Werk die kreative Vision eines großen Künstlers, das weiterlebt, obwohl sein Schöpfer gestorben ist." (Walter Gropius, 1953, zit. nach: Ausst.-Kat. Oskar Schlemmer. Das Bauhaus und der Weg in die Moderne, Stuttgart 2019, S. 24) [CH]
Nachdem er den Wettbewerb für die Wandgestaltung im Brunnenraum des Museum Folkwang gewonnen hatte, experimentierte Schlemmer 1928 mit verschiedenen Techniken. In diesem Zusammenhang bezeichnete er die zunächst auf Nessel oder Leinwand ausgeführten Studien als "Fresko-Studie". Die Entwürfe und Gemälde entstanden in seinem Atelier im Meisterhaus am Bauhaus Dessau; dieses Gemälde im Dezember 1928. Der gesamte Zyklus – auch die dritte, endgültige und installierte Fassung von 1930 – schuf er auf Leinwand und zog sie auf Sperrholzplatten auf, jedoch nicht als Fresko.
Als der Künstler die Studien 1929, 1930 und 1931 zu Ausstellungen einsandte, bezeichnete er sie in seinen Listen als Fresken-Studie, versehen mit den Buchstaben A bis D beziehungsweise mit römischen Ziffern. In der Hoffnung, sie als eigenständige Gemälde in Galerien verkaufen zu können, bezeichnete Schlemmer die kleineren Ölbilder verso mit eigenständigen Titeln, die keinen direkten Bezug mehr zum Folkwang-Zyklus aufwiesen.
Zu Lebzeiten des Künstlers wurden seine Gemälde zum Folkwang-Zyklus 1930 in der XVII. Biennale in Venedig und 1931 in der ersten Ausstellung deutscher Avantgarde in "Modern German Painting and Sculpture" im Museum of Modern Art in New York (Katalog S. 34 mit Text) ausgestellt.
Zahlreiche dieser Tafeln, auch von der Version 1928 sowie der Version von 1930 gesamt, wurden von den Nationalsozialisten im Zuge der Aktion "Entartete Kunst" 1937 beschlagnahmt und gelten als verschollen oder zerstört.
© 2025 C. Raman Schlemmer.
78
Oskar Schlemmer
Jünglingsgruppe in Braun, 1928.
Kunstharz auf Nessel, auf Holz
Schätzung:
€ 280.000 Ergebnis:
€ 322.500 (inklusive Aufgeld)
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Undine Schleifer
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.
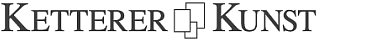



 Lot 78
Lot 78 
