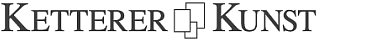61
Wassily Kandinsky
Behauptend, 1926.
Öl auf Leinwand
Schätzung:
€ 1.000.000 Ergebnis:
€ 3.135.000 (inklusive Aufgeld)
61
Wassily Kandinsky
Behauptend, 1926.
Öl auf Leinwand
Schätzung:
€ 1.000.000 Ergebnis:
€ 3.135.000 (inklusive Aufgeld)
Wassily Kandinsky
1866 - 1944
Behauptend. 1926.
Öl auf Leinwand.
Links unten mit dem Künstlermonogramm bezeichnet und datiert "26". Verso auf der Leinwand mit dem Künstlersignet und der Werknummer "No 355" bezeichnet sowie auf dem Keilrahmen betitelt und mit den Maßangaben bezeichnet. 45,5 x 53,3 cm (17,9 x 20,9 in).
Verzeichnet in der Handliste II des Künstlers unter der Nummer "355". In der Literatur ist das Werk auch mit den Titeln "Confirming" und "Asserting" zu finden.[CH].
• Ab den 1930er Jahren Teil der legendären Sammlung von Solomon R. Guggenheim, New York (direkt vom Künstler erworben).
• Im Entstehungsjahr ist Kandinsky Meister am Bauhaus in Dessau.
• Im selben Jahr publiziert er die für die abstrakte Malerei bahnbrechende Abhandlung "Punkt und Linie zu Fläche".
• 1930 in der Ausstellungsreihe "The Blue Four" gezeigt, mit der die Kunsthändlerin Galka Scheyer die Kunst von Kandinsky, Klee, Feininger und Jawlensky auf dem amerikanischen Markt etabliert.
• Vergleichbare Werke sind Teil musealer Sammlungen, darunter das Museum Folkwang, Essen, das Los Angeles County Museum of Art, und das Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
• Seit 45 Jahren Teil einer bedeutenden Berliner Privatsammlung.
PROVENIENZ: Sammlung Solomon R. Guggenheim (1861-1949), New York (direkt vom Künstler erworben, spätestens 1936).
The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (1937 als Stiftung des Vorgenannten, bis 1964).
Sammlung Nathan Cummings, New York (wohl 1964 vom Vorgenannten erworben: Sotheby's, London).
James Goodman Gallery, New York.
Privatsammlung Berlin (1980 vom Vorgenannten erworben).
AUSSTELLUNG: The Blue Four. Kandinsky, Braxton Gallery, Los Angeles, 1.3.-15.3.1930, Kat.-Nr. 11.
Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, Gibbes Memorial Art Gallery, Charleston, 1.3.-12.4.1936, Kat.-Nr. 83 (m. SW-Abb., a. d. Keilrahmen m. d. Ausstellungsetikett).
Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, Philadelphia Art Alliance, Philadelphia, 8.-28.2.1937, Kat.-Nr. 95 (m. SW-Abb.).
Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, Gibbes Art Gallery, Charleston, 7.3.-17.4.1938, Kat.-Nr. 126 (m. SW-Abb.).
Art of Tomorrow, Museum of Non-Objective Painting, New York, Juni 1939, Kat.-Nr. 280 (m. SW-Abb.).
Memorial Exhibition, Museum of Non-Objective Painting, New York, 15.3.-15.5.1945, Kat.-Nr. 92 (m. Abb.).
Selections from the Nathan Cummings Collection, National Gallery of Art, Washington, D.C., 27.6.-7.9.1970, Kat.-Nr. 27 (m. Abb.).
Major Works from the Collection of Nathan Cummings, Art Institute of Chicago, Oktober 1973, Kat.-Nr. 61 (m. Farbabb.).
LITERATUR: Hans Konrad Roethel, Jean K. Benjamin, Kandinsky. Werkverzeichnis der Ölgemälde, Bd. 2: 1916-1944, München 1984, S. 741, WVZ-Nr. 799 (m. SW-Abb.).
- -
Hilla Rebay (Hrsg.), Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, New York 1936 (m. SW.-Abb. u. d. Titel "Confirming").
Hilla Rebay (Hrsg.), Second enlarged catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, New York 1937, S. 35, Kat.-Nr. 95 (m. SW-Abb. u. d. Titel "Confirming").
Hilla Rebay (Hrsg.), Third Enlarged Catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, New York 1938, Kat.-Nr. 126 (m. SW-Abb. u. d. Titel "Confirming").
Hilla Rebay (Hrsg.), Art of Tomorrow. Fifth Catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, New York 1939, Kat.-Nr. 280 (m. SW-Abb. u. d. Titel "Confirming").
Will Grohmann, Wassily Kandinsky. Life and Work, New York 1958, Kat.-Nr. 231, S. 336 (m. SW-Abb., S. 368).
Sotheby's, London, 30.6.1964, Los 20 (m. Abb.).
Michel Conil La Coste, Kandinsky, New York 1979, S. 70 (m. Farbabb.).
"For thousands of years astronomers, as well as laymen, believed that the earth was the center of the universe, around which all other planets revolved. [..] For an even longer period of time there was a belief that the object in painting was the center around which art must move. Artists of the Twentieth Century have discovered that the object is just as far from being the center of art as the earth is from being the focal point of the universe."
Hilla von Rebay, Beraterin für die Sammlung Solomon R. Guggenheim und Direktorin des Museum of Non-Objective Painting (heute Solomon R. Guggenheim Museum), in: Ausst.-Kat. Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, Gibbes Memorial Art Gallery, Charleston 1936, zit. nach: https://www.guggenheim.org/articles/checklist/the-first-five-books.
1866 - 1944
Behauptend. 1926.
Öl auf Leinwand.
Links unten mit dem Künstlermonogramm bezeichnet und datiert "26". Verso auf der Leinwand mit dem Künstlersignet und der Werknummer "No 355" bezeichnet sowie auf dem Keilrahmen betitelt und mit den Maßangaben bezeichnet. 45,5 x 53,3 cm (17,9 x 20,9 in).
Verzeichnet in der Handliste II des Künstlers unter der Nummer "355". In der Literatur ist das Werk auch mit den Titeln "Confirming" und "Asserting" zu finden.[CH].
• Ab den 1930er Jahren Teil der legendären Sammlung von Solomon R. Guggenheim, New York (direkt vom Künstler erworben).
• Im Entstehungsjahr ist Kandinsky Meister am Bauhaus in Dessau.
• Im selben Jahr publiziert er die für die abstrakte Malerei bahnbrechende Abhandlung "Punkt und Linie zu Fläche".
• 1930 in der Ausstellungsreihe "The Blue Four" gezeigt, mit der die Kunsthändlerin Galka Scheyer die Kunst von Kandinsky, Klee, Feininger und Jawlensky auf dem amerikanischen Markt etabliert.
• Vergleichbare Werke sind Teil musealer Sammlungen, darunter das Museum Folkwang, Essen, das Los Angeles County Museum of Art, und das Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
• Seit 45 Jahren Teil einer bedeutenden Berliner Privatsammlung.
PROVENIENZ: Sammlung Solomon R. Guggenheim (1861-1949), New York (direkt vom Künstler erworben, spätestens 1936).
The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York (1937 als Stiftung des Vorgenannten, bis 1964).
Sammlung Nathan Cummings, New York (wohl 1964 vom Vorgenannten erworben: Sotheby's, London).
James Goodman Gallery, New York.
Privatsammlung Berlin (1980 vom Vorgenannten erworben).
AUSSTELLUNG: The Blue Four. Kandinsky, Braxton Gallery, Los Angeles, 1.3.-15.3.1930, Kat.-Nr. 11.
Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, Gibbes Memorial Art Gallery, Charleston, 1.3.-12.4.1936, Kat.-Nr. 83 (m. SW-Abb., a. d. Keilrahmen m. d. Ausstellungsetikett).
Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, Philadelphia Art Alliance, Philadelphia, 8.-28.2.1937, Kat.-Nr. 95 (m. SW-Abb.).
Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, Gibbes Art Gallery, Charleston, 7.3.-17.4.1938, Kat.-Nr. 126 (m. SW-Abb.).
Art of Tomorrow, Museum of Non-Objective Painting, New York, Juni 1939, Kat.-Nr. 280 (m. SW-Abb.).
Memorial Exhibition, Museum of Non-Objective Painting, New York, 15.3.-15.5.1945, Kat.-Nr. 92 (m. Abb.).
Selections from the Nathan Cummings Collection, National Gallery of Art, Washington, D.C., 27.6.-7.9.1970, Kat.-Nr. 27 (m. Abb.).
Major Works from the Collection of Nathan Cummings, Art Institute of Chicago, Oktober 1973, Kat.-Nr. 61 (m. Farbabb.).
LITERATUR: Hans Konrad Roethel, Jean K. Benjamin, Kandinsky. Werkverzeichnis der Ölgemälde, Bd. 2: 1916-1944, München 1984, S. 741, WVZ-Nr. 799 (m. SW-Abb.).
- -
Hilla Rebay (Hrsg.), Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, New York 1936 (m. SW.-Abb. u. d. Titel "Confirming").
Hilla Rebay (Hrsg.), Second enlarged catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, New York 1937, S. 35, Kat.-Nr. 95 (m. SW-Abb. u. d. Titel "Confirming").
Hilla Rebay (Hrsg.), Third Enlarged Catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, New York 1938, Kat.-Nr. 126 (m. SW-Abb. u. d. Titel "Confirming").
Hilla Rebay (Hrsg.), Art of Tomorrow. Fifth Catalogue of the Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, New York 1939, Kat.-Nr. 280 (m. SW-Abb. u. d. Titel "Confirming").
Will Grohmann, Wassily Kandinsky. Life and Work, New York 1958, Kat.-Nr. 231, S. 336 (m. SW-Abb., S. 368).
Sotheby's, London, 30.6.1964, Los 20 (m. Abb.).
Michel Conil La Coste, Kandinsky, New York 1979, S. 70 (m. Farbabb.).
"For thousands of years astronomers, as well as laymen, believed that the earth was the center of the universe, around which all other planets revolved. [..] For an even longer period of time there was a belief that the object in painting was the center around which art must move. Artists of the Twentieth Century have discovered that the object is just as far from being the center of art as the earth is from being the focal point of the universe."
Hilla von Rebay, Beraterin für die Sammlung Solomon R. Guggenheim und Direktorin des Museum of Non-Objective Painting (heute Solomon R. Guggenheim Museum), in: Ausst.-Kat. Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings, Gibbes Memorial Art Gallery, Charleston 1936, zit. nach: https://www.guggenheim.org/articles/checklist/the-first-five-books.
Kandinsky am Bauhaus in Weimar und Dessau
Im Juli 1922 beginnt Wassily Kandinsky seine Lehrtätigkeit am Weimarer Bauhaus. Ihm wird ein Teil der Grundausbildung übertragen, er lehrt "Analytisches Zeichnen", den Vorkurs "Abstrakte Formelemente" sowie "Gestaltungslehre Farbe" und übernimmt zudem die künstlerische Leitung der Werkstatt für Wandmalerei. Später übernimmt er auch den Unterrichtsbereich "Freie Malerei". Mitte der 1920er Jahre siedelt das Bauhaus von Weimar nach Dessau über und Nina und Wassily Kandinsky beziehen eines der gerade fertiggestellten Meisterhäuser. Es ist ein Doppelhaus, das sie mit dem Ehepaar Klee bewohnen, zu dem sie eine lebenslange, sehr enge freundschaftliche und künstlerische Verbindung unterhalten.
In Dessau erlebt Kandinsky eine äußerst schöpferische Phase. Er arbeitet an neuen, revolutionären Bildlösungen, die ihn bis heute als einer der Pioniere der abstrakten Malerei ausweisen.
Kandinskys geometrische Abstraktion
"Nach der dramatischen Phase, die von 1910 bis 1919 dauerte, begann jetzt die konstruktive Phase. Die Bilder sind klar durchkonstruiert und erinnern an Architekturen, weshalb man auch von seiner architektonischen Epoche spricht, die noch in der Weimarer Zeit begann. Zwischen 1925 und 1928 liegt seine sogenannte Epoche der Kreise." (Nina Kandinsky, Kandinsky am Bauhaus, Halle/Saale 2008, S. 76)
Inspiriert vom russischen Konstruktivismus verändert Kandinsky zu Beginn der 1920er Jahre seinen expressiven Vorkriegsstil. In deutlich hellerer Palette werden seine Formen geometrischer: Das Formen-Repertoire umfasst nun Kreise, Vierecke, Dreiecke und Pfeilformen, aber auch Linienbündel, Schachbrettstrukturen und bestimmte Zeichen, weiche Kanten werden durch scharfe Konturen ersetzt. Er selbst bezeichnet diese neue Ausrichtung als "kühle Abstraktion" und veröffentlicht dazu 1925 auch einen Artikel im "Cicerone". Seine Gebilde schweben nun frei im Raum, überkreuzen und durchdringen einander oder gruppieren sich um ein imaginäres Zentrum. Es entstehen höchst komplexe Kompositionen mit einer Vielzahl an Formen und Farben.
Wohl durch wichtige Impulse der niederländischen, am Bauhaus in Weimar durch Theo van Doesburg (1883–1931) vertretenen Künstlervereinigung "De Stijl" beschäftigen sich Kandinsky und seine Bauhaus-Kollegen ab den frühen 1920er Jahren bildnerisch sehr intensiv mit dem Quadrat. Kandinsky nutzt die geometrische Form als integralen Bestandteil seiner abstrakten Kompositionen, insbesondere in seiner Auseinandersetzung mit der Farbe und ihrer Korrelation mit der ihr zugewiesenen Form, denn Fläche und Raum, Form und Farbigkeit sind unweigerlich miteinander verknüpft: Kein Element kann ohne das andere existieren.
Behauptend – Affirming – Confirming
"Behauptend" [in der Literatur auch unter "Affirming" und "Confirming" zu finden] spiegelt die Elemente wider, die Kandinsky in seiner Abhandlung "Punkt und Linie zu Fläche" beschreibt, die er Anfang des Jahres veröffentlicht.
Seine Überlegungen zu den künstlerischen Mitteln abstrakter Malerei, den Hauptelementen seiner Formensprache, ihrem Ausdruck und ihrer psychologischen Wirkung zeigen sich an vielen Stellen dieser durchdachten, präzise formulierten Komposition. Zum einen visualisiert das Gemälde Kandinskys Auffassung, dass die Frage der Form auf dem richtigen Verhältnis der drei primären Flächenformen basiert: Innerhalb mehrerer klar voneinander abgegrenzter, großzügiger und sich zum Teil überlagernder Flächen sind hier kleinere und größere Varianten der klassischen geometrischen Formen Kreis, Rechteck bzw. Quadrat und Dreieck angeordnet, die Kandinsky auch in Streifen und Schachbrettmuster umwandelt. Formen und Flächen sind in bestimmten Winkeln zueinander angeordnet und evozieren eine gewisse Räumlichkeit.
Sowohl kompositorisch als auch in Form und Farbe zeugt das Werk von einer besonderen Klarheit und einer für die Bauhaus-Philosophie charakteristischen Ordnung und Ausgewogenheit, die vielen anderen Werken nicht gegeben ist. Betont wird dies zusätzlich durch die deutlichen, vielfältigen Kontraste, die Kandinsky hier verwendet. Ein starker Hell-Dunkel-Kontrast ordnet die Bildfläche, das Zentrum bevölkern kleine Mengen pointierter Komplementär-Kontraste – Rot neben Grün, Violett neben Gelb – und Qualitätskontraste, bei denen reine, leuchtende Farben neben getrübten stumpferen Farben liegen. Bei genauerer Betrachtung wirkt die gesamte Darstellung schließlich wie ein Meisterstück der Farbenlehre: Kandinsky nutzt Kontraste, Schattierungen und Sättigungen, lässt Farbflächen und Formen einander überlagern und an den Überschneidungen die exakten, daraus resultierenden Mischfarben entstehen.
Ein elementares Anliegen der Bauhaus-Künstler ist damals auch die Darstellung von Bewegung. Pfeile, Dreiecke und Diagonalen werden eingesetzt, um den Eindruck von Antrieb und Zielrichtung zu evozieren. In "Behauptend" verwendet Kandinsky das Dreieck wie einen Pfeil, der eine Dynamik von außen nach innen erzeugt und den Blick wie ein Wegweiser in das Zentrum des Bildes lenkt.
Nicht nur Kandinskys eigene Auseinandersetzungen mit den grundlegenden bildnerischen Gestaltungsmitteln Farbe und Form und ihren wechselseitigen Beziehungen, sondern auch die in der gesamten Bauhaus-Bewegung gegenwärtigen künstlerischen Themen und Prinzipien verschmelzen hier zu einem großen Ganzen.
Auftakt der legendären Sammlung Solomon R. Guggenheim, New York
Die Namen Solomon R. Guggenheim und Wassily Kandinsky sind seit jeher eng miteinander verknüpft. Zeit ihres Lebens pflegen die beiden Männer einen regelmäßigen Austausch, doch die initiale Kontaktaufnahme ist auf die deutsche Künstlerin Hilla Rebay von Ehrenwiesen zurückzuführen. Sie ist es, die Guggenheim bei seinem Vorhaben, eine große Sammlung moderner Kunst aufzubauen, beratend unterstützt und den Industriellen mit dem Künstler bekannt macht.
Sie selbst lernt Kandinskys Kunst bereits 1916, u. a. über dessen Schrift "Über das Geistige in der Kunst", kennen und beschäftigt sich bereits in diesen Jahren intensiv mit der europäischen Avantgarde, für die sie später auch Guggenheim begeistern kann. Durch ihren Einfluss beginnt dieser, sich erstmals für die Werke lebender Künstler zu interessieren, insbesondere für die gegenstandslose, nicht-figurative bzw. abstrakte Kunst ohne Bezug zur realen Welt wie die damals gänzlich neuartigen Arbeiten von Wassily Kandinsky oder die von Rebays ehemaligem Liebhaber Rudolf Bauer, aber auch von Robert Delaunay und László Moholy-Nagy. "They weren’t collecting what was fashionable, what was accepted, but seeking out art that was different." (Guggenheim-Kuratorin Megan Fontanella, zit. nach: Caitlin Dover, The Makers of the Guggenheim, 6.2.2017, https://www.guggenheim.org/articles/checklist/the-makers-of-the-guggenheim)
Guggenheim selbst erklärt: "Everybody was telling me that this modern stuff was the bunk. So as I’ve always been interested in things that people told me were the bunk, I decided that therefore there must be beauty in modern art. I got to feel those pictures so deeply that I wanted them to live with me." (Zit. nach: https://www.guggenheim.org/about-us/history/solomon-r-guggenheim)
Erste Gemälde von Wassily Kandinsky kaufen Hilla von Rebay und Solomon R. Guggenheim bereits 1929. Im darauffolgenden Jahr schreibt von Rebay an den Künstler: "Sehr verehrter Herr Kandinsky, [...] ich wollte Ihnen heute mitteilen, daß ich so sehr hoffe daß Sie in den nächsten Tagen in Dessau sind – da wir nur Ihretwegen nach Dessau kommen – Mr. Guggenheim seine Frau u. ich – die wir Ihre große Kunst so lieben. Er besitzt den weißen Rand, das helle Bild, Schwarze Linien u. noch andere ihrer Meisterwerke […]. Mr. G. hat hier meine Freunde Léger, Gleizes, Braque, Délaunay, Chagall u. Mondrian kennen gelernt aber er liebt Bauer’s u. ihre Bilder am Meisten. Sie werden da einen feinen großen Menschen kennenlernen, der allem Großen zugänglich ist u. begeisterungsfähig. Vor einem Jahr kannte er diese Kunst noch gar nicht, da man ja selten Gutes sieht in New Jork von abstrakter Kunst." (Hilla von Rebay an Wassily Kandinsky, 25.6.1930, zit. nach: Ausst.-Kat. Art of Tomorrow, München 2005, S. 91)
Wie geplant bricht das Ehepaar Guggenheim im Sommer 1930, gemeinsam mit Hilla von Rebay, auf eine Kunst-Reise nach Europa auf. Am 7. Juli besuchen sie das Ehepaar Kandinsky in Dessau. Kandinsky schenkt Guggenheim ein Exemplar seiner kurz zuvor erschienenen Schrift "Punkt und Linie zur Fläche" und Guggenheim erwirbt vor Ort gleich vier Gemälde des Künstlers. Nina Kandinsky wird über das erste Kennenlernen Jahre später rückblickend notieren: "Guggenheim war eine imposante Erscheinung, ein kultivierter und bescheidener Herr." (Nina Kandinsky, 1976, zit. nach: ebd., S. 92)
Nach der Machtergreifung der NSDAP und der Schließung des Bauhauses 1933 leben Nina und Wassily Kandinsky in Frankreich, im Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine. In den Sommern 1935 und 1936 sind erneut Besuche Guggenheims und von Rebays dokumentiert, während derer sie einige weitere Gemälde Kandinskys erwerben, vermutlich auch das hier angebotene Gemälde, das sich u. a. auf einer Werkliste mit der französisch angehauchten Überschrift "Collection de Mr. S. R. Guggenheim, New York" und auch auf einer handschriftlichen Liste mit einem Hinweis in französischer Sprache wiederfindet: "Gugg.-Foundation acheté direct. chez moi [Gugg.-Foundation direkt bei mir erworben]" (Bibliothèque Kandinsky, Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris).
In den 1930er und 1940er Jahren erfolgen weitere Ankäufe. Einen Teil der bis dahin zusammengetragenen, beeindruckenden Sammlung stellen die Guggenheims damals in ihren geräumigen Suiten im Plaza Hotel aus. Weitere Arbeiten befinden sich in ihrem Landhaus Trilora Court in Sands Point, Long Island. Doch schon bald ist die Art und Weise der Präsentation für die Qualität der gezeigten Werke nicht mehr angemessen. Bald organisiert von Rebay eine erste museale Wanderausstellung der Werke, die den Grundstein der Sammlung Guggenheim bilden: Ab 1936 sind sie in der Gibbes Memorial Art Gallery (heute Gibbes Museum of Art) in Charleston, South Carolina, in der Philadelphia Art Alliance, und 1939 im Baltimore Museum of Art zu sehen. Auch "Behauptend" ist auf dieser wichtigen "Tournee" dabei, die von fünf umfassenden Katalogen begleitet wird. Sie sind innerhalb der Sammlungsgeschichte heute als "The First Five Books" bekannt.
1939 erhält die Guggenheim Foundation, der von Rebay nun als Kuratorin und Direktorin vorsteht, endlich einen festen Standort: Das "Museum of Non-Objective Painting", der Vorläufer des heutigen Guggenheim Museum, wird in New York eröffnet. Seit 1952 fungiert es als Solomon R. Guggenheim Museum und ist seit 1959 in dem weltberühmten, von Frank Lloyd-Wright geplanten Gebäude an der Upper East Side beheimatet.
Neben zahlreichen großformatigen Gemälden, die sich zum Teil bis heute in der Guggenheim Foundation befinden, gehört auch "Behauptend" in den 1930er Jahren zu den Grundsteinen dieser heute absolut legendären Sammlung und der Entstehungsgeschichte eines der heute weltweit führenden und einflussreichsten Museen. [CH]
Im Juli 1922 beginnt Wassily Kandinsky seine Lehrtätigkeit am Weimarer Bauhaus. Ihm wird ein Teil der Grundausbildung übertragen, er lehrt "Analytisches Zeichnen", den Vorkurs "Abstrakte Formelemente" sowie "Gestaltungslehre Farbe" und übernimmt zudem die künstlerische Leitung der Werkstatt für Wandmalerei. Später übernimmt er auch den Unterrichtsbereich "Freie Malerei". Mitte der 1920er Jahre siedelt das Bauhaus von Weimar nach Dessau über und Nina und Wassily Kandinsky beziehen eines der gerade fertiggestellten Meisterhäuser. Es ist ein Doppelhaus, das sie mit dem Ehepaar Klee bewohnen, zu dem sie eine lebenslange, sehr enge freundschaftliche und künstlerische Verbindung unterhalten.
In Dessau erlebt Kandinsky eine äußerst schöpferische Phase. Er arbeitet an neuen, revolutionären Bildlösungen, die ihn bis heute als einer der Pioniere der abstrakten Malerei ausweisen.
Kandinskys geometrische Abstraktion
"Nach der dramatischen Phase, die von 1910 bis 1919 dauerte, begann jetzt die konstruktive Phase. Die Bilder sind klar durchkonstruiert und erinnern an Architekturen, weshalb man auch von seiner architektonischen Epoche spricht, die noch in der Weimarer Zeit begann. Zwischen 1925 und 1928 liegt seine sogenannte Epoche der Kreise." (Nina Kandinsky, Kandinsky am Bauhaus, Halle/Saale 2008, S. 76)
Inspiriert vom russischen Konstruktivismus verändert Kandinsky zu Beginn der 1920er Jahre seinen expressiven Vorkriegsstil. In deutlich hellerer Palette werden seine Formen geometrischer: Das Formen-Repertoire umfasst nun Kreise, Vierecke, Dreiecke und Pfeilformen, aber auch Linienbündel, Schachbrettstrukturen und bestimmte Zeichen, weiche Kanten werden durch scharfe Konturen ersetzt. Er selbst bezeichnet diese neue Ausrichtung als "kühle Abstraktion" und veröffentlicht dazu 1925 auch einen Artikel im "Cicerone". Seine Gebilde schweben nun frei im Raum, überkreuzen und durchdringen einander oder gruppieren sich um ein imaginäres Zentrum. Es entstehen höchst komplexe Kompositionen mit einer Vielzahl an Formen und Farben.
Wohl durch wichtige Impulse der niederländischen, am Bauhaus in Weimar durch Theo van Doesburg (1883–1931) vertretenen Künstlervereinigung "De Stijl" beschäftigen sich Kandinsky und seine Bauhaus-Kollegen ab den frühen 1920er Jahren bildnerisch sehr intensiv mit dem Quadrat. Kandinsky nutzt die geometrische Form als integralen Bestandteil seiner abstrakten Kompositionen, insbesondere in seiner Auseinandersetzung mit der Farbe und ihrer Korrelation mit der ihr zugewiesenen Form, denn Fläche und Raum, Form und Farbigkeit sind unweigerlich miteinander verknüpft: Kein Element kann ohne das andere existieren.
Behauptend – Affirming – Confirming
"Behauptend" [in der Literatur auch unter "Affirming" und "Confirming" zu finden] spiegelt die Elemente wider, die Kandinsky in seiner Abhandlung "Punkt und Linie zu Fläche" beschreibt, die er Anfang des Jahres veröffentlicht.
Seine Überlegungen zu den künstlerischen Mitteln abstrakter Malerei, den Hauptelementen seiner Formensprache, ihrem Ausdruck und ihrer psychologischen Wirkung zeigen sich an vielen Stellen dieser durchdachten, präzise formulierten Komposition. Zum einen visualisiert das Gemälde Kandinskys Auffassung, dass die Frage der Form auf dem richtigen Verhältnis der drei primären Flächenformen basiert: Innerhalb mehrerer klar voneinander abgegrenzter, großzügiger und sich zum Teil überlagernder Flächen sind hier kleinere und größere Varianten der klassischen geometrischen Formen Kreis, Rechteck bzw. Quadrat und Dreieck angeordnet, die Kandinsky auch in Streifen und Schachbrettmuster umwandelt. Formen und Flächen sind in bestimmten Winkeln zueinander angeordnet und evozieren eine gewisse Räumlichkeit.
Sowohl kompositorisch als auch in Form und Farbe zeugt das Werk von einer besonderen Klarheit und einer für die Bauhaus-Philosophie charakteristischen Ordnung und Ausgewogenheit, die vielen anderen Werken nicht gegeben ist. Betont wird dies zusätzlich durch die deutlichen, vielfältigen Kontraste, die Kandinsky hier verwendet. Ein starker Hell-Dunkel-Kontrast ordnet die Bildfläche, das Zentrum bevölkern kleine Mengen pointierter Komplementär-Kontraste – Rot neben Grün, Violett neben Gelb – und Qualitätskontraste, bei denen reine, leuchtende Farben neben getrübten stumpferen Farben liegen. Bei genauerer Betrachtung wirkt die gesamte Darstellung schließlich wie ein Meisterstück der Farbenlehre: Kandinsky nutzt Kontraste, Schattierungen und Sättigungen, lässt Farbflächen und Formen einander überlagern und an den Überschneidungen die exakten, daraus resultierenden Mischfarben entstehen.
Ein elementares Anliegen der Bauhaus-Künstler ist damals auch die Darstellung von Bewegung. Pfeile, Dreiecke und Diagonalen werden eingesetzt, um den Eindruck von Antrieb und Zielrichtung zu evozieren. In "Behauptend" verwendet Kandinsky das Dreieck wie einen Pfeil, der eine Dynamik von außen nach innen erzeugt und den Blick wie ein Wegweiser in das Zentrum des Bildes lenkt.
Nicht nur Kandinskys eigene Auseinandersetzungen mit den grundlegenden bildnerischen Gestaltungsmitteln Farbe und Form und ihren wechselseitigen Beziehungen, sondern auch die in der gesamten Bauhaus-Bewegung gegenwärtigen künstlerischen Themen und Prinzipien verschmelzen hier zu einem großen Ganzen.
Auftakt der legendären Sammlung Solomon R. Guggenheim, New York
Die Namen Solomon R. Guggenheim und Wassily Kandinsky sind seit jeher eng miteinander verknüpft. Zeit ihres Lebens pflegen die beiden Männer einen regelmäßigen Austausch, doch die initiale Kontaktaufnahme ist auf die deutsche Künstlerin Hilla Rebay von Ehrenwiesen zurückzuführen. Sie ist es, die Guggenheim bei seinem Vorhaben, eine große Sammlung moderner Kunst aufzubauen, beratend unterstützt und den Industriellen mit dem Künstler bekannt macht.
Sie selbst lernt Kandinskys Kunst bereits 1916, u. a. über dessen Schrift "Über das Geistige in der Kunst", kennen und beschäftigt sich bereits in diesen Jahren intensiv mit der europäischen Avantgarde, für die sie später auch Guggenheim begeistern kann. Durch ihren Einfluss beginnt dieser, sich erstmals für die Werke lebender Künstler zu interessieren, insbesondere für die gegenstandslose, nicht-figurative bzw. abstrakte Kunst ohne Bezug zur realen Welt wie die damals gänzlich neuartigen Arbeiten von Wassily Kandinsky oder die von Rebays ehemaligem Liebhaber Rudolf Bauer, aber auch von Robert Delaunay und László Moholy-Nagy. "They weren’t collecting what was fashionable, what was accepted, but seeking out art that was different." (Guggenheim-Kuratorin Megan Fontanella, zit. nach: Caitlin Dover, The Makers of the Guggenheim, 6.2.2017, https://www.guggenheim.org/articles/checklist/the-makers-of-the-guggenheim)
Guggenheim selbst erklärt: "Everybody was telling me that this modern stuff was the bunk. So as I’ve always been interested in things that people told me were the bunk, I decided that therefore there must be beauty in modern art. I got to feel those pictures so deeply that I wanted them to live with me." (Zit. nach: https://www.guggenheim.org/about-us/history/solomon-r-guggenheim)
Erste Gemälde von Wassily Kandinsky kaufen Hilla von Rebay und Solomon R. Guggenheim bereits 1929. Im darauffolgenden Jahr schreibt von Rebay an den Künstler: "Sehr verehrter Herr Kandinsky, [...] ich wollte Ihnen heute mitteilen, daß ich so sehr hoffe daß Sie in den nächsten Tagen in Dessau sind – da wir nur Ihretwegen nach Dessau kommen – Mr. Guggenheim seine Frau u. ich – die wir Ihre große Kunst so lieben. Er besitzt den weißen Rand, das helle Bild, Schwarze Linien u. noch andere ihrer Meisterwerke […]. Mr. G. hat hier meine Freunde Léger, Gleizes, Braque, Délaunay, Chagall u. Mondrian kennen gelernt aber er liebt Bauer’s u. ihre Bilder am Meisten. Sie werden da einen feinen großen Menschen kennenlernen, der allem Großen zugänglich ist u. begeisterungsfähig. Vor einem Jahr kannte er diese Kunst noch gar nicht, da man ja selten Gutes sieht in New Jork von abstrakter Kunst." (Hilla von Rebay an Wassily Kandinsky, 25.6.1930, zit. nach: Ausst.-Kat. Art of Tomorrow, München 2005, S. 91)
Wie geplant bricht das Ehepaar Guggenheim im Sommer 1930, gemeinsam mit Hilla von Rebay, auf eine Kunst-Reise nach Europa auf. Am 7. Juli besuchen sie das Ehepaar Kandinsky in Dessau. Kandinsky schenkt Guggenheim ein Exemplar seiner kurz zuvor erschienenen Schrift "Punkt und Linie zur Fläche" und Guggenheim erwirbt vor Ort gleich vier Gemälde des Künstlers. Nina Kandinsky wird über das erste Kennenlernen Jahre später rückblickend notieren: "Guggenheim war eine imposante Erscheinung, ein kultivierter und bescheidener Herr." (Nina Kandinsky, 1976, zit. nach: ebd., S. 92)
Nach der Machtergreifung der NSDAP und der Schließung des Bauhauses 1933 leben Nina und Wassily Kandinsky in Frankreich, im Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine. In den Sommern 1935 und 1936 sind erneut Besuche Guggenheims und von Rebays dokumentiert, während derer sie einige weitere Gemälde Kandinskys erwerben, vermutlich auch das hier angebotene Gemälde, das sich u. a. auf einer Werkliste mit der französisch angehauchten Überschrift "Collection de Mr. S. R. Guggenheim, New York" und auch auf einer handschriftlichen Liste mit einem Hinweis in französischer Sprache wiederfindet: "Gugg.-Foundation acheté direct. chez moi [Gugg.-Foundation direkt bei mir erworben]" (Bibliothèque Kandinsky, Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris).
In den 1930er und 1940er Jahren erfolgen weitere Ankäufe. Einen Teil der bis dahin zusammengetragenen, beeindruckenden Sammlung stellen die Guggenheims damals in ihren geräumigen Suiten im Plaza Hotel aus. Weitere Arbeiten befinden sich in ihrem Landhaus Trilora Court in Sands Point, Long Island. Doch schon bald ist die Art und Weise der Präsentation für die Qualität der gezeigten Werke nicht mehr angemessen. Bald organisiert von Rebay eine erste museale Wanderausstellung der Werke, die den Grundstein der Sammlung Guggenheim bilden: Ab 1936 sind sie in der Gibbes Memorial Art Gallery (heute Gibbes Museum of Art) in Charleston, South Carolina, in der Philadelphia Art Alliance, und 1939 im Baltimore Museum of Art zu sehen. Auch "Behauptend" ist auf dieser wichtigen "Tournee" dabei, die von fünf umfassenden Katalogen begleitet wird. Sie sind innerhalb der Sammlungsgeschichte heute als "The First Five Books" bekannt.
1939 erhält die Guggenheim Foundation, der von Rebay nun als Kuratorin und Direktorin vorsteht, endlich einen festen Standort: Das "Museum of Non-Objective Painting", der Vorläufer des heutigen Guggenheim Museum, wird in New York eröffnet. Seit 1952 fungiert es als Solomon R. Guggenheim Museum und ist seit 1959 in dem weltberühmten, von Frank Lloyd-Wright geplanten Gebäude an der Upper East Side beheimatet.
Neben zahlreichen großformatigen Gemälden, die sich zum Teil bis heute in der Guggenheim Foundation befinden, gehört auch "Behauptend" in den 1930er Jahren zu den Grundsteinen dieser heute absolut legendären Sammlung und der Entstehungsgeschichte eines der heute weltweit führenden und einflussreichsten Museen. [CH]
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Undine Schleifer
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.