Rahmenbild
76
Heinrich Campendonk
Im Garten - Frau, Pferd, Ziege (Gartenbild I), 1915.
Öl auf Holz (Türelement)
Schätzpreis: € 600.000 - 800.000
Heinrich Campendonk
1889 - 1957
Im Garten - Frau, Pferd, Ziege (Gartenbild I). 1915.
Öl auf Holz (Türelement).
Verso signiert und datiert. 54,6 x 59,7 cm (21,4 x 23,5 in).
Dokumentiert durch die handschriftliche Bilderliste von Heinrich Campendonk. [CH].
• Liebeserklärung im Angesicht des Ersten Weltkriegs: Mit kräftigen Farben und lebensbejahender Vitalität macht der junge Campendonk seine Frau Adda zur Protagonistin seiner Darstellung.
• 1916 erstmals ausgestellt (Der Sturm, Herwarth Walden, Berlin).
• In Folge der künstlerischen Emanzipation vom "Blauen Reiter" schafft Campendonk in diesen Jahren meisterlich inszenierte Kompositionen.
• Diese um 1914 bis 1918 entstandenen Gemälde gehören zu den gesuchtesten Werken des Künstlers auf dem internationalen Auktionsmarkt.
• Insbesondere aus den beiden Jahren 1915 und 1916 sind nur sehr wenige seiner Arbeiten in Öl und Tempera erhalten (Wvz Firmenich, S. 134).
PROVENIENZ: Privatsammlung Deutschland.
Privatsammlung North Carolina (durch Erbschaft vom Vorgenannten).
Achim Moeller Fine Art, New York (2002 vom Vorgenannten erworben).
Triton Foundation, Niederlande (2003 vom Vorgenannten erworben).
Privatsammlung Köln (2023 vom Vorgenannten erworben).
AUSSTELLUNG: Campendonk. Gemälde und Aquarelle. Zeichnungen / Holzschnitte, Der Sturm, Berlin, Oktober 1916, Kat.-Nr. 7 (mit dem Titel "Gartenbild I", verso mit dem handschriftl. bez. Galerieetikett).
Rausch und Reduktion. Heinrich Campendonk 1889-1957, Stadtmuseum Penzberg, 13.9.-18.11.2007, S. 172 (m. Abb., S. 55).
More than Color. Fauvism and Expressionism from the Collection of the Triton Foundation / Meer dan kleur. Fauvisme en expressionisme uit de collectie van de Triton Foundation, Gemeentemuseum, Den Haag, 11.4.-6.9.2009, S. 24f. (m. Abb., S. 24).
Kandinsky en Der Blaue Reiter, Gemeentemuseum, Den Haag, 6.2.-24.5.2010, S. 192 u. 231, Kat.-Nr. 73 (m. Abb., S. 192).
Avant-gardes 1870 to the present. The Collection of the Triton Foundation, Kunsthal, Rotterdam, 7.10.2012-20.1.2013, S. 16, 193, 196, 214 u. 541 (m. Abb., S. 16 u. 215 u. m. Detail-Abb., S. 194f.).
LITERATUR: Andrea Firmenich, Heinrich Campendonk 1889-1957. Leben und expressionistisches Werk, mit Werkkatalog des malerischen Œuvres, Recklinghausen 1989, WVZ-Nr. 510.
Aufrufzeit: 05.12.2025 - ca. 19.30 h +/- 20 Min.
1889 - 1957
Im Garten - Frau, Pferd, Ziege (Gartenbild I). 1915.
Öl auf Holz (Türelement).
Verso signiert und datiert. 54,6 x 59,7 cm (21,4 x 23,5 in).
Dokumentiert durch die handschriftliche Bilderliste von Heinrich Campendonk. [CH].
• Liebeserklärung im Angesicht des Ersten Weltkriegs: Mit kräftigen Farben und lebensbejahender Vitalität macht der junge Campendonk seine Frau Adda zur Protagonistin seiner Darstellung.
• 1916 erstmals ausgestellt (Der Sturm, Herwarth Walden, Berlin).
• In Folge der künstlerischen Emanzipation vom "Blauen Reiter" schafft Campendonk in diesen Jahren meisterlich inszenierte Kompositionen.
• Diese um 1914 bis 1918 entstandenen Gemälde gehören zu den gesuchtesten Werken des Künstlers auf dem internationalen Auktionsmarkt.
• Insbesondere aus den beiden Jahren 1915 und 1916 sind nur sehr wenige seiner Arbeiten in Öl und Tempera erhalten (Wvz Firmenich, S. 134).
PROVENIENZ: Privatsammlung Deutschland.
Privatsammlung North Carolina (durch Erbschaft vom Vorgenannten).
Achim Moeller Fine Art, New York (2002 vom Vorgenannten erworben).
Triton Foundation, Niederlande (2003 vom Vorgenannten erworben).
Privatsammlung Köln (2023 vom Vorgenannten erworben).
AUSSTELLUNG: Campendonk. Gemälde und Aquarelle. Zeichnungen / Holzschnitte, Der Sturm, Berlin, Oktober 1916, Kat.-Nr. 7 (mit dem Titel "Gartenbild I", verso mit dem handschriftl. bez. Galerieetikett).
Rausch und Reduktion. Heinrich Campendonk 1889-1957, Stadtmuseum Penzberg, 13.9.-18.11.2007, S. 172 (m. Abb., S. 55).
More than Color. Fauvism and Expressionism from the Collection of the Triton Foundation / Meer dan kleur. Fauvisme en expressionisme uit de collectie van de Triton Foundation, Gemeentemuseum, Den Haag, 11.4.-6.9.2009, S. 24f. (m. Abb., S. 24).
Kandinsky en Der Blaue Reiter, Gemeentemuseum, Den Haag, 6.2.-24.5.2010, S. 192 u. 231, Kat.-Nr. 73 (m. Abb., S. 192).
Avant-gardes 1870 to the present. The Collection of the Triton Foundation, Kunsthal, Rotterdam, 7.10.2012-20.1.2013, S. 16, 193, 196, 214 u. 541 (m. Abb., S. 16 u. 215 u. m. Detail-Abb., S. 194f.).
LITERATUR: Andrea Firmenich, Heinrich Campendonk 1889-1957. Leben und expressionistisches Werk, mit Werkkatalog des malerischen Œuvres, Recklinghausen 1989, WVZ-Nr. 510.
Aufrufzeit: 05.12.2025 - ca. 19.30 h +/- 20 Min.
Heinrich Campendonk im "Blauen Reiter"
Ab 1905 studiert der junge Heinrich Campendonk zunächst an der kurz zuvor gegründeten progressiven Kunstgewerbeschule in Krefeld, an der er nicht die konventionelle akademische Ausbildung, sondern auch neue kunstpädagogische Ideen und eine von naturalistischen Vorstellungen unabhängige Bildgestaltung kennenlernt. Aus finanziellen Gründen muss Campendonk seine Ausbildung vorzeitig abbrechen, gibt sein Vorhaben, freischaffender Künstler zu werden, jedoch nicht auf.
Im Oktober 1911 folgt er der Einladung von Franz Marc und reist nach München, lernt die Protagonisten des "Blauen Reiter" Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinksy, Paul Klee, August Macke und Gabriele Münter kennen und zieht schließlich nach Sindelsdorf in Oberbayern, wo auch Macke und Marc mit ihren Partnerinnen leben. 1911 und 1912 ist er an der ersten und zweiten Ausstellung des "Blauen Reiter" in der Galerie Thannhauser in München und in Köln beteiligt, später auch an weiteren maßgeblichen Ausstellungen zur klassischen Moderne vor dem Ersten Weltkrieg, darunter 1913 am "Ersten deutschen Herbstsalon" in Herwarth Waldens Galerie "Der Sturm" in Berlin.
Durch die enge künstlerische Auseinandersetzung mit seinen Künstlerkollegen des "Blauen Reiter" vollzieht sich in Campendonks Schaffen nun ein enormer Stilwandel. Insbesondere die Bildwelten Franz Marcs inspirieren ihn nachhaltig, mit dem er zudem gemeinsame künstlerische Anschauungen und Ausdrucksformen teilt. Zusätzliche künstlerische Anregungen erhält er u. a. von Bildern Marc Chagalls, die er vermutlich während seiner Aufenthalte in Berlin und sicherlich auch durch Reproduktionen kennenlernt. Deren seltsam mystisch-fantastische Qualitäten sind in den Gemälden Heinrich Campendonks ebenso zu finden wie einzelne an Franz Marc erinnernde, kubistisch-expressive geometrische Formen, wie sie auch hier den Hintergrund ausfüllen.
Zwischen Traumwelt und Schöpfungsgeschichte: Campendonks malerische Bilderrätsel
In seinem kühnen Bemühen um neue Ausdrucksmöglichkeiten einer ganz neuen Anschauung der Welt und der Wirklichkeit schafft Campendonk in diesen Jahren flächig-konstruktive, bizarre, traumähnliche Tier- und Landschaftsszenen in kräftig-leuchtenden Farbfacetten und mit lyrischer, fast märchenhafter Grundstimmung.
Zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion changierend, entstehen Kompositionen mit wiederkehrenden, symbolisch aufgeladenen und nur schwer zu entschlüsselnden Motiven. Zahlreiche Tiere bevölkern diese geheimnisvollen, rätselhaften Szenen, darunter Pferde und Ziegen, Kühe, Rehe und Hähne – meist an der Seite eines Menschen und umgeben von stilisierten Pflanzen sowie architektonischen und abstrahierten Formen. Nahezu ohne räumliche Tiefenwirkung und in nur losem kompositorischen Zusammenhang reiht der Künstler die einzelnen Bildinhalte versatzstückartig aneinander, narrative Komponenten werden vermieden.
Auch in unserem Bild stellt er der die linke Bildhälfte einnehmenden weiblichen Figur zwei Tierfiguren zur Seite. Die Bildmitte okkupiert ein baumähnliches Gewächs, das die Komposition in zwei Hälften unterteilt. Tiere und Frauenfigur bilden als Dreiergespann eine Einheit, bevölkern die Komposition jedoch als einzelne, beziehungslose Elemente: Jedes Lebewesen
schaut und bewegt sich in eine andere Richtung. "Es handelt sich dabei nicht etwa um Figurationen einer romantischen Märchenwelt und auch nicht wie bei Franz Marc um spiritualisierte Verkörperungen animalischen Wesens, sondern um elementare und in ihrer Art und Erscheinungsform phänomenale und bedeutungsvolle Individuationen der Natur und des Lebens. In Verbindung mit dem Menschen […] haben sie sozusagen den Charakter von Attributen, die symbolisch den natürlichen Zusammenhang der Schöpfung veranschaulichen." (Mathias T. Engels, Campendonk. Holzschnitte (Werkverzeichnis), Stuttgart 1959, S. 9ff., zit. nach: Die Rheinischen Expressionisten, Recklinghausen 1980, S. 96)
Die Tiere fungieren demnach als prominente Begleiter für die vereinzelte weibliche Protagonistin und visualisieren und symbolisieren damit, ganz ohne narrative Komponente, das wohl den meisten seiner Arbeiten zugrunde liegende Bildthema: den ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens, die gesamte Schöpfung.
1915: Bedrohungen des Krieges und innere Sehnsucht
Der Beginn des Ersten Weltkriegs läutet bereits das Ende der Künstlergruppe ein, denn Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky müssen Deutschland aufgrund ihrer Herkunft bald verlassen, August Macke fällt schon 1914 in der Champagne und Franz Marc zwei Jahre später bei Verdun. Der Verlust seiner Freunde und Künstlerkollegen erschüttert Campendonk zutiefst. Anders als Franz Marc, der den Krieg zunächst als Chance für Veränderungen und Erneuerung begreift, sieht ihn Campendonk als große Bedrohung.
1913 hatte er seine Freundin und engste Vertraute Adelheid "Adda" Deichmann geheiratet, die bereits 1912 zu ihm nach Sindelsdorf gezogen war. Im Februar 1915, im Entstehungsjahr des hier gezeigten Gemäldes, wird ihr erster Sohn geboren. Kurz darauf wird Campendonk für eine erste militärische Grundausbildung eingezogen und wird hin und wieder für militärische Dienste herangezogen. Er lebt in Ungewissheit darüber, ob und wann er für den Kriegsdienst eingezogen würde. Dokumente und Zeichnungen aus dieser Zeit dokumentieren die verzweifelte seelische Verfassung des Künstlers. Eine seiner selbst gezeichneten Postkarten aus dem Jahr 1915 zeigt einen Schimmel und vermutlich einen Tiger, darunter ein Herz und die Widmung "Meiner Adda". Eine weitere Karte zeigt Addas Gesicht im Profil und notiert dazu "1915 – Ich liebe Adda". Auf einer zweiten Postkarte, dem Pendant, prangt sein eigenes Konterfei und darunter die Bemerkung "7. Sept. 1915 – Ich bete Dich wiedersehen zu dürfen" (siehe Wvz 548 Po und 551 Po).
Dieser stetigen Angst und Bedrohung, der Trauer und Verzweiflung setzt Campendonk magische Farbwelten und eine traumhafte, kontemplative Isolation entgegen, möglicherweise Ausdruck eines sehnlichen Wunsches nach Frieden und Rückkehr einer Harmonie von Mensch und Natur.
Ankommen: Idylle in Seeshaupt
Im April erleidet Campendonk einen Zusammenbruch, wird daraufhin für dienstunfähig erklärt und entlassen, was ihm möglicherweise das Leben rettet und ihn für eine gewisse Zeit zu seiner Familie zurückführt. Im Angesicht der großen Tragödien und der Schrecken des Krieges zieht sich der Künstler 1916 mit seiner Familie nach Seeshaupt an den Starnberger See zurück, wo sie zwei Etagen eines Bauernhauses inmitten von Wiesen und Obstbäumen beziehen. Der Künstler wird nun endgültig vom Militärdienst freigestellt und findet nun in der Idylle dieser ländlichen, abgeschiedenen Umgebung gemeinsam mit seiner Familie Rückzugsort, Harmonie und inneren Frieden.
Im Oktober 1916 wird das hier angebotene Gemälde mit dem Titel "Gartenbild I" in einer Einzelausstellung in der legendären Galerie "Der Sturm" in Berlin ausgestellt. Im Berliner Börsenkurier heißt es in der Nachbesprechung: "Campendonk steht in der großen Reihe von Expressionisten: man kann bei ihm bereits von moderner Überlieferung sprechen. Das Gespenstige eines Odilon Redon, die tropische Pracht von Gauguin, das Farbenauge eines Chagall, die Tiergeheimnisse von Marc, hie und da sogar das Farbengewitter von Kandinsky […] finden durch ihn einen höchst persönlichen Gesamtausdruck." (Theodor Däubler, Ausstellung im "Sturm", in: Berliner Börsenkurier, 4. Oktober 1916, zit. nach: Die Rheinischen Expressionisten, Recklinghausen 1980, S. 111) [CH]
Ab 1905 studiert der junge Heinrich Campendonk zunächst an der kurz zuvor gegründeten progressiven Kunstgewerbeschule in Krefeld, an der er nicht die konventionelle akademische Ausbildung, sondern auch neue kunstpädagogische Ideen und eine von naturalistischen Vorstellungen unabhängige Bildgestaltung kennenlernt. Aus finanziellen Gründen muss Campendonk seine Ausbildung vorzeitig abbrechen, gibt sein Vorhaben, freischaffender Künstler zu werden, jedoch nicht auf.
Im Oktober 1911 folgt er der Einladung von Franz Marc und reist nach München, lernt die Protagonisten des "Blauen Reiter" Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinksy, Paul Klee, August Macke und Gabriele Münter kennen und zieht schließlich nach Sindelsdorf in Oberbayern, wo auch Macke und Marc mit ihren Partnerinnen leben. 1911 und 1912 ist er an der ersten und zweiten Ausstellung des "Blauen Reiter" in der Galerie Thannhauser in München und in Köln beteiligt, später auch an weiteren maßgeblichen Ausstellungen zur klassischen Moderne vor dem Ersten Weltkrieg, darunter 1913 am "Ersten deutschen Herbstsalon" in Herwarth Waldens Galerie "Der Sturm" in Berlin.
Durch die enge künstlerische Auseinandersetzung mit seinen Künstlerkollegen des "Blauen Reiter" vollzieht sich in Campendonks Schaffen nun ein enormer Stilwandel. Insbesondere die Bildwelten Franz Marcs inspirieren ihn nachhaltig, mit dem er zudem gemeinsame künstlerische Anschauungen und Ausdrucksformen teilt. Zusätzliche künstlerische Anregungen erhält er u. a. von Bildern Marc Chagalls, die er vermutlich während seiner Aufenthalte in Berlin und sicherlich auch durch Reproduktionen kennenlernt. Deren seltsam mystisch-fantastische Qualitäten sind in den Gemälden Heinrich Campendonks ebenso zu finden wie einzelne an Franz Marc erinnernde, kubistisch-expressive geometrische Formen, wie sie auch hier den Hintergrund ausfüllen.
Zwischen Traumwelt und Schöpfungsgeschichte: Campendonks malerische Bilderrätsel
In seinem kühnen Bemühen um neue Ausdrucksmöglichkeiten einer ganz neuen Anschauung der Welt und der Wirklichkeit schafft Campendonk in diesen Jahren flächig-konstruktive, bizarre, traumähnliche Tier- und Landschaftsszenen in kräftig-leuchtenden Farbfacetten und mit lyrischer, fast märchenhafter Grundstimmung.
Zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion changierend, entstehen Kompositionen mit wiederkehrenden, symbolisch aufgeladenen und nur schwer zu entschlüsselnden Motiven. Zahlreiche Tiere bevölkern diese geheimnisvollen, rätselhaften Szenen, darunter Pferde und Ziegen, Kühe, Rehe und Hähne – meist an der Seite eines Menschen und umgeben von stilisierten Pflanzen sowie architektonischen und abstrahierten Formen. Nahezu ohne räumliche Tiefenwirkung und in nur losem kompositorischen Zusammenhang reiht der Künstler die einzelnen Bildinhalte versatzstückartig aneinander, narrative Komponenten werden vermieden.
Auch in unserem Bild stellt er der die linke Bildhälfte einnehmenden weiblichen Figur zwei Tierfiguren zur Seite. Die Bildmitte okkupiert ein baumähnliches Gewächs, das die Komposition in zwei Hälften unterteilt. Tiere und Frauenfigur bilden als Dreiergespann eine Einheit, bevölkern die Komposition jedoch als einzelne, beziehungslose Elemente: Jedes Lebewesen
schaut und bewegt sich in eine andere Richtung. "Es handelt sich dabei nicht etwa um Figurationen einer romantischen Märchenwelt und auch nicht wie bei Franz Marc um spiritualisierte Verkörperungen animalischen Wesens, sondern um elementare und in ihrer Art und Erscheinungsform phänomenale und bedeutungsvolle Individuationen der Natur und des Lebens. In Verbindung mit dem Menschen […] haben sie sozusagen den Charakter von Attributen, die symbolisch den natürlichen Zusammenhang der Schöpfung veranschaulichen." (Mathias T. Engels, Campendonk. Holzschnitte (Werkverzeichnis), Stuttgart 1959, S. 9ff., zit. nach: Die Rheinischen Expressionisten, Recklinghausen 1980, S. 96)
Die Tiere fungieren demnach als prominente Begleiter für die vereinzelte weibliche Protagonistin und visualisieren und symbolisieren damit, ganz ohne narrative Komponente, das wohl den meisten seiner Arbeiten zugrunde liegende Bildthema: den ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens, die gesamte Schöpfung.
1915: Bedrohungen des Krieges und innere Sehnsucht
Der Beginn des Ersten Weltkriegs läutet bereits das Ende der Künstlergruppe ein, denn Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky müssen Deutschland aufgrund ihrer Herkunft bald verlassen, August Macke fällt schon 1914 in der Champagne und Franz Marc zwei Jahre später bei Verdun. Der Verlust seiner Freunde und Künstlerkollegen erschüttert Campendonk zutiefst. Anders als Franz Marc, der den Krieg zunächst als Chance für Veränderungen und Erneuerung begreift, sieht ihn Campendonk als große Bedrohung.
1913 hatte er seine Freundin und engste Vertraute Adelheid "Adda" Deichmann geheiratet, die bereits 1912 zu ihm nach Sindelsdorf gezogen war. Im Februar 1915, im Entstehungsjahr des hier gezeigten Gemäldes, wird ihr erster Sohn geboren. Kurz darauf wird Campendonk für eine erste militärische Grundausbildung eingezogen und wird hin und wieder für militärische Dienste herangezogen. Er lebt in Ungewissheit darüber, ob und wann er für den Kriegsdienst eingezogen würde. Dokumente und Zeichnungen aus dieser Zeit dokumentieren die verzweifelte seelische Verfassung des Künstlers. Eine seiner selbst gezeichneten Postkarten aus dem Jahr 1915 zeigt einen Schimmel und vermutlich einen Tiger, darunter ein Herz und die Widmung "Meiner Adda". Eine weitere Karte zeigt Addas Gesicht im Profil und notiert dazu "1915 – Ich liebe Adda". Auf einer zweiten Postkarte, dem Pendant, prangt sein eigenes Konterfei und darunter die Bemerkung "7. Sept. 1915 – Ich bete Dich wiedersehen zu dürfen" (siehe Wvz 548 Po und 551 Po).
Dieser stetigen Angst und Bedrohung, der Trauer und Verzweiflung setzt Campendonk magische Farbwelten und eine traumhafte, kontemplative Isolation entgegen, möglicherweise Ausdruck eines sehnlichen Wunsches nach Frieden und Rückkehr einer Harmonie von Mensch und Natur.
Ankommen: Idylle in Seeshaupt
Im April erleidet Campendonk einen Zusammenbruch, wird daraufhin für dienstunfähig erklärt und entlassen, was ihm möglicherweise das Leben rettet und ihn für eine gewisse Zeit zu seiner Familie zurückführt. Im Angesicht der großen Tragödien und der Schrecken des Krieges zieht sich der Künstler 1916 mit seiner Familie nach Seeshaupt an den Starnberger See zurück, wo sie zwei Etagen eines Bauernhauses inmitten von Wiesen und Obstbäumen beziehen. Der Künstler wird nun endgültig vom Militärdienst freigestellt und findet nun in der Idylle dieser ländlichen, abgeschiedenen Umgebung gemeinsam mit seiner Familie Rückzugsort, Harmonie und inneren Frieden.
Im Oktober 1916 wird das hier angebotene Gemälde mit dem Titel "Gartenbild I" in einer Einzelausstellung in der legendären Galerie "Der Sturm" in Berlin ausgestellt. Im Berliner Börsenkurier heißt es in der Nachbesprechung: "Campendonk steht in der großen Reihe von Expressionisten: man kann bei ihm bereits von moderner Überlieferung sprechen. Das Gespenstige eines Odilon Redon, die tropische Pracht von Gauguin, das Farbenauge eines Chagall, die Tiergeheimnisse von Marc, hie und da sogar das Farbengewitter von Kandinsky […] finden durch ihn einen höchst persönlichen Gesamtausdruck." (Theodor Däubler, Ausstellung im "Sturm", in: Berliner Börsenkurier, 4. Oktober 1916, zit. nach: Die Rheinischen Expressionisten, Recklinghausen 1980, S. 111) [CH]
76
Heinrich Campendonk
Im Garten - Frau, Pferd, Ziege (Gartenbild I), 1915.
Öl auf Holz (Türelement)
Schätzpreis: € 600.000 - 800.000
Aufgeld, Steuern und Folgerechtsvergütung zu Heinrich Campendonk "Im Garten - Frau, Pferd, Ziege (Gartenbild I)"
Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.
Berechnung bei Differenzbesteuerung:
Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 34 %.
Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 29 % berechnet und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.
Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 22 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.
Das Aufgeld enthält die Umsatzsteuer, diese wird jedoch nicht ausgewiesen.
Berechnung bei Regelbesteuerung:
Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 29 %.
Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 23 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.
Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.
Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % erhoben.
Wir bitten um schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung, sollten Sie Regelbesteuerung wünschen.
Berechnung der Folgerechtsvergütung:
Für Werke lebender Künstler oder von Künstlern, die vor weniger als 70 Jahren verstorben sind, fällt gemäß § 26 UrhG eine Folgerechtsvergütung in folgender Höhe an:
4% des Zuschlags ab 400,00 Euro bis zu 50.000 Euro,
weitere 3 % Prozent für den Teil des Zuschlags von 50.000,01 bis 200.000 Euro,
weitere 1 % für den Teil des Zuschlags von 200.000,01 bis 350.000 Euro,
weitere 0,5 Prozent für den Teil des Zuschlags von 350.000,01 bis 500.000 Euro und
weitere 0,25 Prozent für den Teil Zuschlags über 500.000 Euro.
Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiterveräußerung beträgt höchstens 12.500 Euro.
Die Folgerechtsvergütung ist umsatzsteuerfrei.
Berechnung bei Differenzbesteuerung:
Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 34 %.
Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 29 % berechnet und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.
Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 22 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.
Das Aufgeld enthält die Umsatzsteuer, diese wird jedoch nicht ausgewiesen.
Berechnung bei Regelbesteuerung:
Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 29 %.
Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 23 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.
Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro übersteigt, wird ein Aufgeld von 15 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, hinzuaddiert.
Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % erhoben.
Wir bitten um schriftliche Mitteilung vor Rechnungsstellung, sollten Sie Regelbesteuerung wünschen.
Berechnung der Folgerechtsvergütung:
Für Werke lebender Künstler oder von Künstlern, die vor weniger als 70 Jahren verstorben sind, fällt gemäß § 26 UrhG eine Folgerechtsvergütung in folgender Höhe an:
4% des Zuschlags ab 400,00 Euro bis zu 50.000 Euro,
weitere 3 % Prozent für den Teil des Zuschlags von 50.000,01 bis 200.000 Euro,
weitere 1 % für den Teil des Zuschlags von 200.000,01 bis 350.000 Euro,
weitere 0,5 Prozent für den Teil des Zuschlags von 350.000,01 bis 500.000 Euro und
weitere 0,25 Prozent für den Teil Zuschlags über 500.000 Euro.
Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiterveräußerung beträgt höchstens 12.500 Euro.
Die Folgerechtsvergütung ist umsatzsteuerfrei.
Hauptsitz
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München
Tel.: +49 (0)89 55 244-0
Fax: +49 (0)89 55 244-177
info@kettererkunst.de
Louisa von Saucken / Undine Schleifer
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 37 49 61-0
Fax: +49 (0)40 37 49 61-66
infohamburg@kettererkunst.de
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
Tel.: +49 (0)30 88 67 53-63
Fax: +49 (0)30 88 67 56-43
infoberlin@kettererkunst.de
Cordula Lichtenberg
Gertrudenstraße 24-28
50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 510 908-15
infokoeln@kettererkunst.de
Hessen
Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel.: +49 (0)62 21 58 80-038
Fax: +49 (0)62 21 58 80-595
infoheidelberg@kettererkunst.de
Nico Kassel, M.A.
Tel.: +49 (0)89 55244-164
Mobil: +49 (0)171 8618661
n.kassel@kettererkunst.de
Wir informieren Sie rechtzeitig.
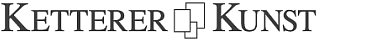



 Lot 76
Lot 76 


