Video
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
Weitere Abbildung
2
Norbert Kricke
Raumplastik, 1961.
mit Silberlot. Auf schwarzem Basaltsockel
Schätzung:
€ 90.000 Ergebnis:
€ 215.900 (inklusive Aufgeld)
Raumplastik. 1961.
mit Silberlot. Auf schwarzem Basaltsockel.
Unikat. Ca. 74 x 58,5 x 57 cm (29,1 x 23 x 22,4 in). Sockel: 10 x 8 x 8 cm (3,9 x 3,1 x 3,1 in).
[JS].
• In seinen legendären "Raumplastiken" gelingt es Kricke, die lineare Ästhetik des Informel in die Dreidimensionalität zu führen.
• Eine der größten bisher auf dem internationalen Auktionsmarkt angebotenen "Raumplastiken".
• Bereits 1961, im Entstehungsjahr der vorliegenden Arbeit, wird Krickes wegweisendes Œuvre mit einer Einzelausstellung im Museum of Modern Art, New York, gewürdigt.
• Im selben Jahr zeigt Kricke diese Plastik in der Galerie Karl Flinker, Paris.
• Aus der Sammlung des ehemaligen französischen Premierministers Edgar Faure, Paris.
• Zeitlos-moderne Ästhetik: Krickes "Raumplastiken" gleichen schwerelos und filigran in den Raum ausgreifenden Strahlenbündeln und gelten als Höhepunkt seines Strebens nach "Einheit von Raum und Zeit".
Wir danken Frau Sabine Kricke-Güse für die freundliche Auskunft. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen.
PROVENIENZ: Galerie Karl Flinker, Paris (1961, direkt vom Künstler).
Edgar Faure, Paris (1961 vom Vorgenannten erworben - mindestens 1976).
Privatsammlung Paris (um 1980 im Pariser Kunsthandel erworben, seither in Familienbesitz).
AUSSTELLUNG: Norbert Kricke, Galerie Karl Flinker, Paris, 15.11.-9.12.1961.
Norbert Kricke. Zeichnungen und Raumplastiken, Staatsgalerie Stuttgart, 11.12.1976-30.1.1977; Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, März/April 1977.
LITERATUR: John Anthony Thwaites, Kricke, Kunst heute 4, Stuttgart 1964 (m. SW-Abb. S. 56).
Norbert Kricke. Zeichnungen und Raumplastiken, Stuttgart 1976, S. 95 (m. SW-Abb.).
"The Museum of Modern Art is happy to present a selection of sculpture and drawings by Norbert Kricke [..]. Kricke is already well established in Europe but has thus far not received the recognition he deserves in New York."
Peter Selz, Museum of Modern Art, New York 1961.
"Mein Problem ist nicht Masse, ist nicht Figur, sondern es ist der Raum und es ist die Bewegung – Raum und Zeit. [..] Ich versuche der Einheit von Raum und Zeit eine Form zu geben."
Norbert Kricke, 1954, zit. nach: Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, München 1988, S. 2.
mit Silberlot. Auf schwarzem Basaltsockel.
Unikat. Ca. 74 x 58,5 x 57 cm (29,1 x 23 x 22,4 in). Sockel: 10 x 8 x 8 cm (3,9 x 3,1 x 3,1 in).
[JS].
• In seinen legendären "Raumplastiken" gelingt es Kricke, die lineare Ästhetik des Informel in die Dreidimensionalität zu führen.
• Eine der größten bisher auf dem internationalen Auktionsmarkt angebotenen "Raumplastiken".
• Bereits 1961, im Entstehungsjahr der vorliegenden Arbeit, wird Krickes wegweisendes Œuvre mit einer Einzelausstellung im Museum of Modern Art, New York, gewürdigt.
• Im selben Jahr zeigt Kricke diese Plastik in der Galerie Karl Flinker, Paris.
• Aus der Sammlung des ehemaligen französischen Premierministers Edgar Faure, Paris.
• Zeitlos-moderne Ästhetik: Krickes "Raumplastiken" gleichen schwerelos und filigran in den Raum ausgreifenden Strahlenbündeln und gelten als Höhepunkt seines Strebens nach "Einheit von Raum und Zeit".
Wir danken Frau Sabine Kricke-Güse für die freundliche Auskunft. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen.
PROVENIENZ: Galerie Karl Flinker, Paris (1961, direkt vom Künstler).
Edgar Faure, Paris (1961 vom Vorgenannten erworben - mindestens 1976).
Privatsammlung Paris (um 1980 im Pariser Kunsthandel erworben, seither in Familienbesitz).
AUSSTELLUNG: Norbert Kricke, Galerie Karl Flinker, Paris, 15.11.-9.12.1961.
Norbert Kricke. Zeichnungen und Raumplastiken, Staatsgalerie Stuttgart, 11.12.1976-30.1.1977; Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, März/April 1977.
LITERATUR: John Anthony Thwaites, Kricke, Kunst heute 4, Stuttgart 1964 (m. SW-Abb. S. 56).
Norbert Kricke. Zeichnungen und Raumplastiken, Stuttgart 1976, S. 95 (m. SW-Abb.).
"The Museum of Modern Art is happy to present a selection of sculpture and drawings by Norbert Kricke [..]. Kricke is already well established in Europe but has thus far not received the recognition he deserves in New York."
Peter Selz, Museum of Modern Art, New York 1961.
"Mein Problem ist nicht Masse, ist nicht Figur, sondern es ist der Raum und es ist die Bewegung – Raum und Zeit. [..] Ich versuche der Einheit von Raum und Zeit eine Form zu geben."
Norbert Kricke, 1954, zit. nach: Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, München 1988, S. 2.
Peter Selz, der Kurator des Museum of Modern Art in New York, beginnt seinen Katalogtext zu Krickes erster Einzelausstellung in den USA 1961 mit den folgenden Worten: "The Museum of Modern Art is happy to present a selection of sculpture and drawings by Norbert Kricke [..]. Kricke is already well established in Europe but has thus far not received the recognition he deserves in New York." Selz hatte bereits damals erkannt, dass Kricke in der Bildhauerei der Nachkriegsmoderne aufgrund seiner intensiven plastischen Erkundung von Raum und Zeit eine herausragende Rolle zukommt. Inspiriert von der konstruktivistischen Plastik um Naum Gabo und Antoine Pevsner entwickelt Kricke in seinen Unikaten eine bis heute einzigartige Formensprache, welche die lineare Ästhetik der informellen Malerei in die Plastik überführt und damit räumlich erfahrbar werden lässt. Kricke beginnt zunächst in den 1950er Jahren damit, die Dynamik der Linie anhand des Verlaufes eines einzelnen gebogenen Drahtes zu erkunden. Für diese frühen, meist farbig gefassten Arbeiten, die mit ihren langen Linienverläufen geradezu das spätere Schaffen des Amerikaners Fred Sandback vorwegzunehmen scheinen, findet dann auch bereits der Titel "Raumplastik" Verwendung. Ab Mitte der 1950er Jahre beginnt Kricke dann mit Linienbündeln zu arbeiten und entwickelt diese bis zum Ende des Jahrzehntes – wie auch in unserer großen "Raumplastik" – weiter bis hin zu mehrteiligen filigranen Linienkonstruktionen, die sich durch ihre einzigartige polyphone Ästhetik auszeichnen. Bündel aus aneinandergelöteten Edelstahlstäben greifen, sich zu feinsten Verästelungen verjüngend, nach allen Seiten in den Raum aus. Filigran und schwerelos wirken Krickes glänzende Schöpfungen. Sie füllen wie Lichtstrahlen den Raum und liefern damit einen äußerst progressiven Beitrag zur Bildhauerei der Nachkriegsmoderne. Wie revolutionär und wegweisend Krickes Schaffen ist, belegt auch die Tatsache, dass eine auf das eigene Werk bezogene Beschreibung des um eine Generation jüngeren amerikanischen Minimal Artist Fred Sandback auch schon für Krickes plastisches Schaffen kaum treffender sein könnte: "Noch Skulptur, wenn auch weniger dicht, mit einer Ambivalenz zwischen Außenraum und Innenraum. Eine Zeichnung, die man bewohnen kann.“ (Fred Sandback, Here and Now, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz 2005). Kricke befreit die Skulptur von der geschlossenen Form, lässt die feine Lineatur abstrakter Zeichnung räumlich und allansichtig werden und schafft mit minimalistisch reduzierten Mitteln eine räumliche Interaktion und Präsenz, die aufgrund ihrer zeitlos-modernen Ästhetik bis heute begeistert. [JS]
2
Norbert Kricke
Raumplastik, 1961.
mit Silberlot. Auf schwarzem Basaltsockel
Schätzung:
€ 90.000 Ergebnis:
€ 215.900 (inklusive Aufgeld)
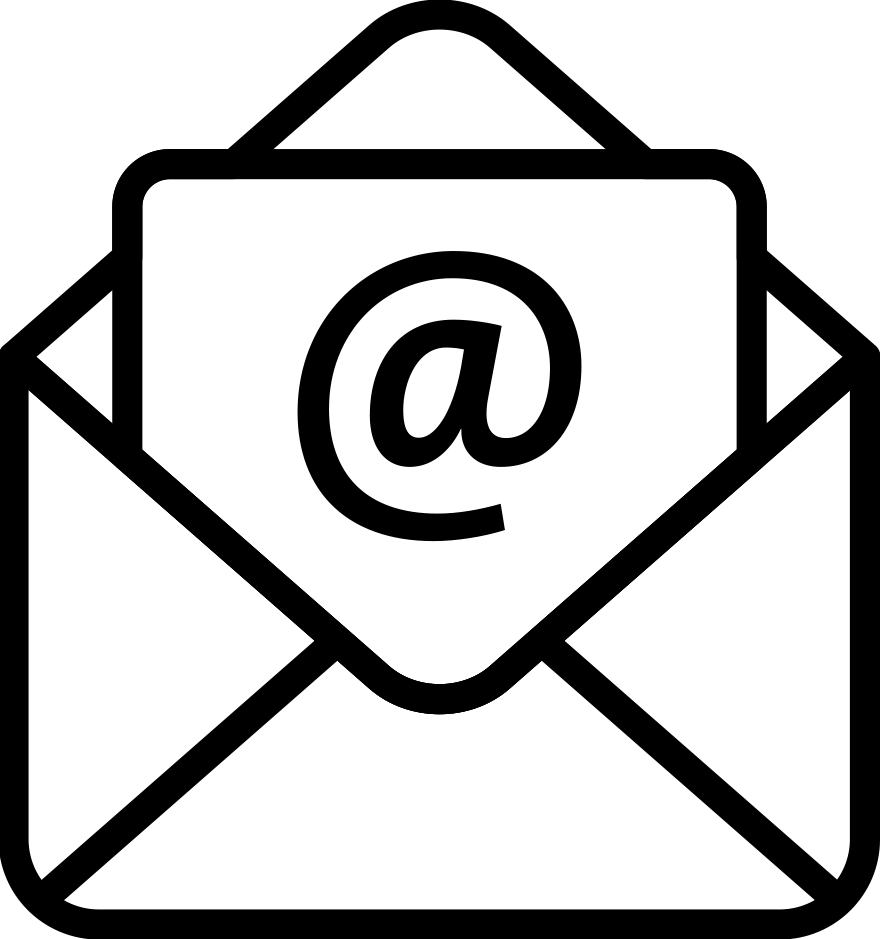
Ihre Lieblingskünstler im Blick!
- Neue Angebote sofort per E-Mail erhalten
- Exklusive Informationen zu kommenden Auktionen und Veranstaltungen
- Kostenlos und unverbindlich
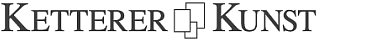



 Lot 2
Lot 2 
