60
Andy Warhol
Goethe, 1982.
Farbserigrafie
Schätzung:
€ 60.000 Ergebnis:
€ 139.700 (inklusive Aufgeld)
Goethe. 1982.
Farbserigrafie.
Feldmann/Schellmann/Defendi II.271. Signiert und nummeriert. Eines von 100 Exemplaren. Auf Lenox Museum-Karton. 96,5 x 96,5 cm (37,9 x 37,9 in), blattgroß.
Blatt 2 des insgesamt 4 Farbserigrafien umfassenden Portfolios. Gedruckt von Rupert Jasen Smith, New York (mit dem Trockenstempel). Herausgegeben von den Editionen Schellmann & Klüser, München/New York, in Zusammenarbeit mit Denise René/Hans Mayer, Düsseldorf (verso mit dem Copyright-Stempel).
• Farbstärkste Version der gesamten Suite "Goethe".
• Eine Ikone der Weltliteratur von Warhol porträtiert.
• Tischbein wird zum Kultmotiv der Pop-Art.
• Seit dem Entstehungsjahr in der selben Sammlung.
PROVENIENZ: Galeria Heinrich Ehrhardt, Madrid.
Privatsammlung Spanien (seit 1982, direkt vom Vorgenannten erworben).
LITERATUR: Forty are better than one. Edition Schellmann 1969-2009, herausgegeben von Jörg Schellmann, Ostfildern 2009, S. 342-343.
"Die Menschen sind einfach phantastisch. Man kann keine schlechten Bilder von ihnen machen."
Andy Warhol, zit. nach Feldmann/Schellmann, Werkverzeichnis der Druckgraphik, 1989, S. 8.
Farbserigrafie.
Feldmann/Schellmann/Defendi II.271. Signiert und nummeriert. Eines von 100 Exemplaren. Auf Lenox Museum-Karton. 96,5 x 96,5 cm (37,9 x 37,9 in), blattgroß.
Blatt 2 des insgesamt 4 Farbserigrafien umfassenden Portfolios. Gedruckt von Rupert Jasen Smith, New York (mit dem Trockenstempel). Herausgegeben von den Editionen Schellmann & Klüser, München/New York, in Zusammenarbeit mit Denise René/Hans Mayer, Düsseldorf (verso mit dem Copyright-Stempel).
• Farbstärkste Version der gesamten Suite "Goethe".
• Eine Ikone der Weltliteratur von Warhol porträtiert.
• Tischbein wird zum Kultmotiv der Pop-Art.
• Seit dem Entstehungsjahr in der selben Sammlung.
PROVENIENZ: Galeria Heinrich Ehrhardt, Madrid.
Privatsammlung Spanien (seit 1982, direkt vom Vorgenannten erworben).
LITERATUR: Forty are better than one. Edition Schellmann 1969-2009, herausgegeben von Jörg Schellmann, Ostfildern 2009, S. 342-343.
"Die Menschen sind einfach phantastisch. Man kann keine schlechten Bilder von ihnen machen."
Andy Warhol, zit. nach Feldmann/Schellmann, Werkverzeichnis der Druckgraphik, 1989, S. 8.
In den 1970er und 1980er Jahren konzentriert sich Warhol auf Portäts und Stillleben und behält den Siebdruck als einzige Technik seiner Grafik und Gemälde bei. Die Serigrafie als künstlerisches Medium ist von der spontanen Mal-Geste ebenso weit entfernt wie die Serienproduktion vom originalen Einzelwerk. Bei Warhol aber liegt die Eindringlichkeit eines Motivs gerade und erst in der Summe der Bilder. Das zugrunde liegende Gestaltungsprinzip ist hier wie in vielen anderen Werken die Variation des immer gleichen ikonografischen Themas. Seine Porträts setzen die Reihe von Prominenten aus Film, Musik, Sport und Politik fort und es kommen historische Figuren wie unser Goethe hinzu. Warhol wird zum führenden Porträtisten seiner Zeit. Dieser Ruhm hallt bis heute nach.
Das Goethe-Porträt ist das erste Werk in einer Reihe von Arbeiten, für die ein historisches Kunstwerk als Referenz genutzt wurde. Für "Goethe" isoliert Warhol einen Ausschnitt des wohl bekanntesten Goethe-Porträts, welches Johann Heinrich Wilhelm Tischbein 1787 malte und das sich heute im Frankfurter Städel befindet. In seinen späten Porträts nimmt er die Einfachheit und Direktheit der Serigrafien der 1960er Jahre wieder auf und fügt innovative Abwandlungen hinzu. Warhol arbeitet in der Goethe-Serie mit mehr offensichtlich von Hand eingeführten Details. Im Gegensatz etwa zu der Marilyn-Porträtserie, in der er ausschließlich mit farbigen Flächen arbeitet. Neben dem bereits in den 1960er eingeführten Prinzip der Farbvariationen differenzieren die zeichnerischen Linien das Bild. Arbeitet Warhol bei seinen Porträtserien oft nach fotografischen Vorlagen entweder aus den Medien oder nach selbst geschossenen Polaroids, reist er für die Goethe-Serie nach Frankfurt ins Städel, um das Originalwerk zu sehen. Der Verleger Siegfried Unseld lädt den Pop-Art-Künstler nach Deutschland ein mit dem Auftrag, eine Variation von Tischbeins Gemälde "Goethe in der römischen Campagna" zu schaffen. Die Fotografin Barbara Klemm hält den Moment fest, als Warhol mit müdem Blick und Rucksack auf dem Rücken wie einer von zahlreichen Touristen vor dem berühmten Gemälde steht. Basierend auf einer Fotoaufnahme transformiert der "Hofmaler der 70er", wie der Kunsthistoriker Robert Rosenblum Warhol bezeichnet (vgl. Robert Rosenblum, Andy Warhol: Der Hofmaler der Siebziger, in: Ausst.-Kat. Andy Warhol, Porträts, Museum of Contemporary Art, Sydney 1993; Anthony d’Offay Gallery, London 1994, München 1993), das Goethe-Bildnis in ein poppiges Porträt der Moderne. [SM]
Das Goethe-Porträt ist das erste Werk in einer Reihe von Arbeiten, für die ein historisches Kunstwerk als Referenz genutzt wurde. Für "Goethe" isoliert Warhol einen Ausschnitt des wohl bekanntesten Goethe-Porträts, welches Johann Heinrich Wilhelm Tischbein 1787 malte und das sich heute im Frankfurter Städel befindet. In seinen späten Porträts nimmt er die Einfachheit und Direktheit der Serigrafien der 1960er Jahre wieder auf und fügt innovative Abwandlungen hinzu. Warhol arbeitet in der Goethe-Serie mit mehr offensichtlich von Hand eingeführten Details. Im Gegensatz etwa zu der Marilyn-Porträtserie, in der er ausschließlich mit farbigen Flächen arbeitet. Neben dem bereits in den 1960er eingeführten Prinzip der Farbvariationen differenzieren die zeichnerischen Linien das Bild. Arbeitet Warhol bei seinen Porträtserien oft nach fotografischen Vorlagen entweder aus den Medien oder nach selbst geschossenen Polaroids, reist er für die Goethe-Serie nach Frankfurt ins Städel, um das Originalwerk zu sehen. Der Verleger Siegfried Unseld lädt den Pop-Art-Künstler nach Deutschland ein mit dem Auftrag, eine Variation von Tischbeins Gemälde "Goethe in der römischen Campagna" zu schaffen. Die Fotografin Barbara Klemm hält den Moment fest, als Warhol mit müdem Blick und Rucksack auf dem Rücken wie einer von zahlreichen Touristen vor dem berühmten Gemälde steht. Basierend auf einer Fotoaufnahme transformiert der "Hofmaler der 70er", wie der Kunsthistoriker Robert Rosenblum Warhol bezeichnet (vgl. Robert Rosenblum, Andy Warhol: Der Hofmaler der Siebziger, in: Ausst.-Kat. Andy Warhol, Porträts, Museum of Contemporary Art, Sydney 1993; Anthony d’Offay Gallery, London 1994, München 1993), das Goethe-Bildnis in ein poppiges Porträt der Moderne. [SM]
60
Andy Warhol
Goethe, 1982.
Farbserigrafie
Schätzung:
€ 60.000 Ergebnis:
€ 139.700 (inklusive Aufgeld)
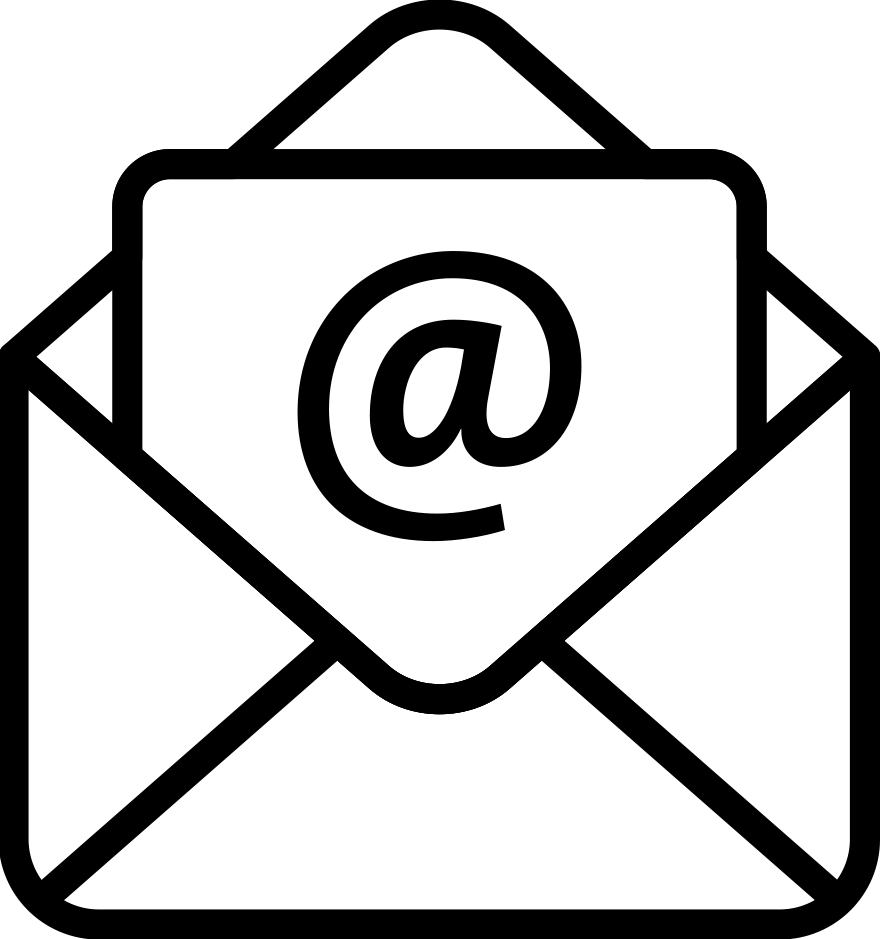
Ihre Lieblingskünstler im Blick!
- Neue Angebote sofort per E-Mail erhalten
- Exklusive Informationen zu kommenden Auktionen und Veranstaltungen
- Kostenlos und unverbindlich
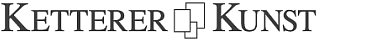



 Lot 60
Lot 60 

